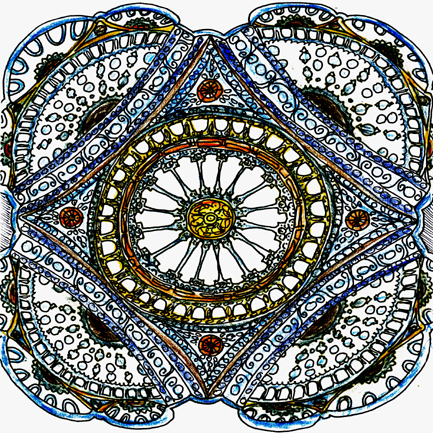24. August
Die Sultan-Ahmet-Moschee in Istanbul wird „Blaue Moschee” genannt, weil bei den dort zu bewundernden, prächtigen Fliesen-Mosaiken Blau die dominierende Farbe ist.
Da eine bildliche Darstellung „beseelter” Wesen in der islamischen Welt vermieden wird – in der sakralen Kunst und Architektur gibt es sogar ein regelrechtes „Bilderverbot” –, zieren überwiegend florale Ornamente die Wände und Kuppeln des Gotteshauses. Und zwar zieren sie die Innenwände und ‑kuppeln, weshalb die ganze Schönheit des (fraglos auch von außen sehr beeindruckenden) Gebäudes sich nur dem erschließt, der Gelegenheit hat, es auch zu betreten.
Seit dem Ruf des Muezzins zum Morgengebet ist schon einige Zeit vergangen, als Inge und ich uns auf den Weg zur Blauen Moschee machen. Weit haben wir es ja nicht.
Tatsächlich ist die Moschee nun wieder auch zur Besichtigung geöffnet.

Unsere Schuhe lassen wir neben dem Eingang stehen.
Einen Moment lang zögere ich, als ich sehe, dass die meisten der dort bereits aufgereihten Paare einen weitaus schäbigeren Eindruck machen als Inges Marken-Turnschuhe und meine brandneuen Ledersandalen… Aber dann denke ich an den alten Mann von gestern – „Allah sieht alles!” – und höre auf, mir Sorgen zu machen.

Ich denke, diese besondere Ruhe rührt nicht nur von den dicken Steinmauern her, die Orte wie diesen vom Lärm der Welt abschirmen. Sie ist vielleicht auch eine Art Nachhall der inneren Stille, Einkehr und Besinnung, die viele tausend Gläubige im Laufe der Jahrhunderte hier gefunden haben mögen.
Diese Atmosphäre der Abgeschiedenheit – quasi eine Verlangsamung jeder Hektik des Alltags und der Außenwelt – scheint mir aber auch die einzige Gemeinsamkeit mit einem christlichen Sakralgebäude vergleichbaren Alters zu sein.
Ich habe noch nie eine Moschee von innen gesehen, und mein erster Eindruck ist der von Leere.
Kein prunkvoller, großer Altar, auf den hin der Raum ausgerichtet ist, kein Gestühl, keine reich verzierte Orgel oder Orgel-Empore, keine Treppchen, Geländer, Abtrennungen, Beichtstühle, und – natürlich – keine Darstellungen Gottes oder seiner Heiligen bzw. Propheten. Die verschlungenen Ornamente der Wand- und Deckenfliesen und die zahllosen, teils wohl sehr kostbaren Teppiche auf dem Boden des Kuppelsaals sind die einzigen dekorativen Elemente; ansonsten wirkt der Raum allein durch seine Größe und die weihevolle Stille.
Die riesigen, an der hohen Decke befestigten Leuchter aus geschwärztem Metall hängen sehr tief, nicht weit über den Köpfen der stehenden oder umherschreitenden Menschen. Sie bringen ein Element funktionaler, moderner Innenarchitektur in den Raum, das erstaunlich gut mit dessen klaren Formen, dem fein gemusterten Fliesen-Wandschmuck und den kleinen und großen Kuppeln harmoniert.
Als wir die Moschee verlassen, schlägt uns die Mittagshitze gnadenlos entgegen. Obwohl die Sultan-Ahmet-Moschee bestimmt nicht mit einer Klimaanlage ausgerüstet ist, herrscht da drin eine um einige Grad kühlere Temperatur, was meine Hochachtung vor den begnadeten Erbauern weiter steigen lässt.
Unsere Schuhe sind noch da, wo wir sie stehen gelassen haben. Wir schlüpfen hinein und schlendern gemächlich die Allee in Richtung Hauptstraße hinab.

Ich bleibe stehen, um noch ein Foto von der Blauen Moschee aus der Entfernung zu machen. Als ich gerade dabei bin, meinen Fotoapparat wieder in meinem Beutel zu verstauen, sprechen uns zwei junge Türken an. Sie wären Studenten und würden nebenher auch als „Tourist Guides” arbeiten – ob wir Interesse an einer Führung durch die Blaue Moschee hätten?
Inge und ich lehnen lachend ab. Nein, die Moschee hätten wir uns gerade schon angeguckt, und außerdem wären wir selbst Studentinnen, keine reichen Touristinnen, und könnten uns keinen „Guide” leisten (geschweige denn zwei).
„No problem,” sagt da der eine der beiden Jungs, sie hätten heute eh’ einen freien Tag, und es wäre ihnen ein Vergnügen, uns ihre Stadt zu zeigen – und zwar kostenlos, „for free”.
Ob wir denn schon entschieden hätten, was wir uns als Nächstes ansehen wollten? Inge und ich beraten kurz auf deutsch.
Zwar sind in den letzten Tagen schon mehrfach ähnliche Angebote an uns herangetragen worden, die von uns größtenteils wortlos ignoriert wurden, aber bei diesen zwei jungen Männern ist es anders – in ihren Jeans, T‑Shirts und Turnschuhen wirken sie tatsächlich wie Studenten (die auch im Hamburger Uni-Viertel nicht auffallen würden), und sie sprechen fließend und beinahe akzentfrei englisch. Und, da sind wir einer Meinung, sie sehen Beide ganz passabel aus…
„Lassen wir uns doch einfach die Hagia Sophia von ihnen zeigen, dann werden wir schon merken, was sie als Fremdenführer drauf haben,” schlägt Inge vor.
„Hagia Sophia? A very good choice,” strahlt einer unserer beiden neuen „Guides”, der sich nun als Ali vorstellt. Sein Freund, etwas schweigsamer, aber ebenso freundlich lächelnd, heißt Yussuf.
Als wir zusammen weitergehen, liefert Ali schon mal eine Probe seines Wissens ab und erzählt uns, warum die Blaue Moschee sechs Minarette hat, also ein bis zwei mehr, als bei einer Moschee dieser Größe üblich: Sultan Ahmet, der sie Anfang des 17. Jahrhundert erbauen ließ und nach dem sie auch benannt ist, soll in einem Anfall von königlichem Größenwahn von seinem Baumeister verlangt haben, die Minarette des Gotteshauses mit Blattgold zu bedecken. Da das unbezahlbar gewesen wäre, der Architekt aber seinem Chef nicht widersprechen konnte, beschloss er einfach so zu tun, als habe er den Sultan falsch verstanden – das türkische Wort für „Gold” klingt nämlich fast so wie die Zahl „Sechs” auf türkisch…
Also baute er dem Sultan eine Moschee mit sechs Türmen.
Was umgehend für einen Riesen-Aufruhr in der islamischen Welt sorgte – denn sechs Minarette hatte bis dato nur die Moschee in Mekka, und dass eine in Istanbul ebenso viele hatte, wurde als Angriff auf die Ausnahmestellung des Pilger-Ortes gewertet. Sultan Ahmet blieb schließlich nichts Anderes übrig, als auf seine Kosten ein siebtes Minarett neben der Moschee in Mekka errichten zu lassen. Womit die Idee mit dem Blattgold wohl endgültig erledigt gewesen sein dürfte.
Bei unserem Rundgang durch die Hagia Sophia erweisen sich Ali und Yussuf als kompetente Guides, die ihre Kenntnisse dazu noch auf unterhaltsame und zum Teil ausgesprochen witzige Weise „an die Frau” bringen können.
Verglichen mit der aus gigantischen Steinblöcken erbauten Hagia Sophia kommt mir die auch nicht gerade kleine Blaue Moschee im Nachhinein nun ausgesprochen elegant, geradezu filigran vor. Es überrascht mich weder, dass die ehemalige Kirche der „Heiligen Weisheit” mehr als tausend Jahre vor der Moschee (532 – 537 n. Chr.) errichtet wurde, noch, dass sie in der Spätantike als achtes Weltwunder galt.
Ich sehe zu den aus riesigen Blöcken zusammengefügten Bögen hinauf und frage mich, wie man die damals, ohne Kräne und anderes Gerät, da wohl hinauf bekommen und so exakt aneinander fügen konnte. Am beeindruckendsten ist zweifellos die zentrale, frei schwebende Hauptkuppel mit einem Durchmesser von mehr als 30 Metern.
Man könne heute, meint Yussuf mit verhaltener Stimme, nicht mehr nachvollziehen, wie die Architekten des Kaisers (ein byzantinischer Gelehrter und ein griechischer Physiker / Mathematiker) es in jener Zeit geschafft haben, eine stabile Kuppel so gewaltigen Ausmaßes zu entwerfen… Für die damals größte und herrlichste Kirche der Welt, die sie ausgerechnet in dieser immer schon erdbebengefährdete Stadt errichten mussten!
Yussuf und Ali zeigen uns auch die Spuren des Umbaus der orthodoxen Kirche in eine islamische Moschee, der in den Jahrzehnten und Jahrhunderten nach der osmanischen Eroberung der Stadt am Goldenen Horn erfolgte.
Seit den 30er Jahren des 20. Jahrhundert wird die Hagia Sophia, auf eine Anregung Atatürks hin, als Museum genutzt, und auch die Spuren ihrer christlichen Vergangenheit werden wieder sichtbar gemacht. So wurden beispielsweise christliche Mosaike von dem Putz befreit, unter dem sie – wegen des bereits erwähnten „Bilderverbots” – während der Nutzung als Moschee verborgen waren.
Auch dass einige Einbauten im Inneren der Hagia Sophia (die nicht zuletzt wegen dieser Einbauten kaum den Eindruck stiller „Leere” hinterlässt) scheinbar zusammenhangslos und „schräg” im Raum stehen, hängt mit diesem Umbau zusammen.
Der Mihrab beispielsweise, jene normalerweise dem Moschee-Eingang gegenüber liegende Nische, die die Gebetsrichtung – also die Richtung, in der Mekka liegt – anzeigt, befindet sich in der Hagia Sophia in einer Ecke. Denn natürlich, erklärt uns Yussuf, haben die christlichen Erbauer ihre Kirche nicht nach Mekka, sondern in Richtung Jerusalem ausgerichtet. Und das ist, von Istanbul aus gesehen, zwar fast dieselbe Richtung, aber eben nur fast…
Die restaurierten christlichen Elemente neben den teilweise äußerst prunkvollen islamischen Ergänzungen, der Goldglanz orthodoxer wie auch osmanischer Insignien, das harmonische Bild eines byzantinischen Kuppelbaus mit vier muslimischen Minaretten und, nicht zuletzt, die Dimensionen der ganzen Anlage sind überwältigend.
Vor allem finde ich es großartig, dass sich partout nicht mehr sagen lässt, welche der beiden Riten, die hier einst praktiziert wurden, mehr zum Gesamteindruck beitragen…
Auch wenn dies vermutlich weder den orthodoxen Christen noch den Muslimen besonders gefallen würde – ich, als keiner Religionsgemeinschaft angehörende „Außenstehende”, komme zu der Auffassung, dass gerade die Tatsache, dass die Hinterlassenschaften beider Glaubensrichtungen sich die Räumlichkeiten der Hagia Sophia „teilen”, den besonderen Zauber dieses altehrwürdigen Gebäudes ausmachen.
Und wenn man dann noch bedenkt, dass es sich bei den zwei genialen Gelehrten, die vor fast eineinhalbtausend Jahren die längst verschollenen Pläne für diesen wundervollen Bau erstellt haben, um einen Türken und um einen Griechen gehandelt hat, also um Angehörige zweier angeblich „seit jeher” verfeindeter Völker – dann wird die Hagia Sophia endgültig zu einem Denkmal für die Blödsinnigkeit aller religiösen, kulturellen und nationalen Grenzen.
Zum Stein gewordenen Beweis dafür, dass Menschen immer dann zu den großartigsten Leistungen fähig sind und die fantastischsten Dinge bewirken, wenn sie alle kleinlichen geistigen Gartenzäune außer Acht lassen.
Nach der Besichtigungsrunde sitzen wir zu viert in einer Teestube, stärken uns mit Çay und diskutieren über Geschichte, Politik und Religion.
Natürlich sind Yussuf und Ali Muslime durch Geburt, aber sie sind keine Gläubigen. Sie gehen nicht zum Gebet in die Moschee und befolgen die Ge- und Verbote Mohammeds ohne Überzeugung und nur soweit, wie es unbedingt nötig ist – um den Schein ihren Familien und den Nachbarn gegenüber zu wahren.
Dafür haben sie ihren Marx gründlich gelesen.
Religion sei Opium für’s Volk, intoniert Ali im Brustton der Überzeugung.
Als ich von meinem Erlebnis mit dem ehrlichen Finder meiner Reisekasse erzähle und dass jener seine gute Tat mit seinem Glauben begründet habe, und als ich dann meine, dass Religion wohl doch nicht immer nur schlecht sei, lächelt Yussuf mich an und sagt, dass solche Religiosität zweifellos Gutes bewirken könne – aber Religion an sich trotzdem schlecht sei.
Als ich ihn verständnislos angucke, lacht er und sagt: „That’s dialectic.”
Die Zwei überzeugen Inge und mich, den Plan einer Topkapi-Besichtigung sausen zu lassen. Der ehemalige Wohn- und Regierungssitz der Osmanen sei so groß wie eine kleine Stadt, beteuern sie, und eigentlich sei sogar ein ganzer Tag noch zu wenig, um auch nur einen Teil der Gebäude und der in ihnen präsentierten Schätze zu sehen.
„You better visit Topkapi, when you come to Istanbul next time…”
Statt des Museums, für dessen Besuch man zudem einen stattlichen Eintrittspreis zahlen müsse, sollten wir uns lieber die alten Festungsanlagen oberhalb des Bosporus von ihnen zeigen lassen.
Wir willigen ein.
Eine dreiviertel Stunde später sind Inge und ich nicht mehr so sicher, ob das eine gute Idee war. Wir sind unseren „Guides” in einen Bus gefolgt, dann irgendwo tief im Bauch der Metropole wieder aus- und in einen anderen Bus eingestiegen – und haben inzwischen nicht mehr den leisesten Schimmer, an welchem Ende der Stadt wir uns eigentlich mittlerweile befinden.
Es scheint in jedem Fall an irgendeinem Rand der Stadt zu sein, denn als wir aus dem zweiten Bus aussteigen und zu Fuß weitergehen, machen Gassen und Gebäude einen zunehmend dörflichen Eindruck. Touristen scheinen sich nicht gerade häufig hierher zu verirren; Inge und ich werden offen angestaunt und Ali und Yussuf mehrmals – offenbar unseretwegen – angesprochen.
Die Gasse wird zu einem Weg, und dieser wird schmaler und führt bergauf, bis sich uns hinter einer Biegung ein phantastischer Ausblick auf den Fluss hinunter darbietet.

Nun haben wir auch die Festung erreicht, und Ali, der an der Bushaltestelle kurz in einem Lebensmittelgeschäft verschwunden und mit zwei weißen Plastiktüten in der Hand wieder herausgekommen war, breitet seine Einkäufe auf einem Steinquader aus: Fladenbrote, Tomaten, ein heller, fester Käse und in Butterbrotpapier gewickelte, rechteckige Stückchen eines Sirup- oder Honig-triefenden Blätterteiggebäcks.
Inge und ich merken jetzt erst, wie hungrig wir inzwischen sind, und so veranstalten wir ein einfaches, aber ungemein befriedigendes Picknick am Fuße der im 15. Jahrhundert von den osmanischen Eroberern erbauten Felsenburg.

Unsere beiden Studenten erzählen von der Belagerung und der Schlacht um Konstantinopel mit solch einer Begeisterung und mit so detaillierten Ausschmückungen, dass ich es schwierig finde, diese Geschichten mit den vorher von ihnen so nüchtern und sachlich vertretenen marxistischen Positionen unter einen Hut zu bringen.
Auf einmal hören sie sich nicht mehr an wie zwei dem Materialismus verpflichtete Intellektuelle, sondern wie zwei kleine Romantiker, die blutige historische Realitäten mit einem blumigen Karl-May-Roman verwechseln.
Und dann sehe ich mich um, betrachte die Mauern und das wild wuchernde Grün um uns herum und denke, hm, genau das ist das hier wahrscheinlich für sie – eine Art Karl-May-Abenteuerspielplatz.
So, wie ich früher mit den Nachbarskindern aus der Siedlung am Hamburger Stadtrand durch das kleine Wäldchen an unserem See geschlichen und getobt bin – entweder war ich eine „edle” Indianerin, oder ich gehörte zur Bande von Robin Hood –, so sind wahrscheinlich der kleine Ali und der kleine Yussuf vor zehn, fünfzehn Jahren hier als unerschrockene Kämpfer des Sultans durchs Unterholz gestürmt…
Ein wenig von der kindlichen Begeisterung hat zumindest Ali auch in sein „erwachsenes”, politisches Denken hinüber gerettet. Eben noch hat er von der klugen Taktik des Sultan Mehmet („the conqueror”) geschwärmt, da ruft er plötzlich im gleichen, entzückten Ton: „Look, a soviet container ship is passing by!”.
Und dann schwärmt er Inge und mir von der stetigen Zunahme des Handels zwischen Türkei und UdSSR vor, und wie großartig diese Handelbeziehungen sowie die Sowjetunion und der Sozialismus generell doch seien.

Ali und Inge klettern auf der Festung und dem Hügel herum, während Yussuf und ich auf dem Steinwall sitzen bleiben, auf den Fluss hinab schauen und uns unterhalten. Wir sprechen sehr offen über unsere Träume, unsere Gefühle, aber auch über unsere Ängste.
Es ist, als würden wir uns schon ewig kennen.
Als ich von meinem Gefühl des Hin- und Hergerissenseins spreche (zwischen dem Bedürfnis, an das Gute in jedem Menschen zu glauben einerseits und der Furcht, betrogen und benutzt zu werden andererseits), lächelt er mich wieder auf diese unglaublich strahlende Art an und meint, es könne mir doch nicht allzu schwer fallen, mich in konkreten Situationen zwischen Vertrauen und Misstrauen zu entscheiden: „You just have to listen to your instinct.”
Er halte mich für eine „open minded person”, fährt er fort, und das sei seiner Erfahrung nach auch der beste Weg, andere Menschen und ihre Absichten richtig einzuschätzen. Wenn ich für Andere offen wäre, würde ich schnell merken, ob ich ihnen trauen könne oder nicht – „and if they can touch your heart or not”.
Wenn ich hingegen versuchen würde, meine Gedanken und Gefühle zu verbergen, eine Maske zu tragen, dann würde das die Distanz zwischen anderen Menschen und mir unnötig vergrößern.
Unaufrichtigkeit verlängere immer nur den Weg, den man mit Offenheit direkt gehen könnte. Und wer diesen längeren Weg wähle, würde ohnehin früher oder später ebenfalls den Punkt erreichen, an dem er die Kommunikation entweder beenden müsse – oder sich doch noch (dann aber möglicherweise zu spät…) öffnen und sein wahres Gesicht hinter der Maske zeigen.
„What do you study,” frage ich Yussuf, „psychology?”
„Economy,” antwortet er und grinst.
Wir reden über Selbstbewusstsein.
Ali und er wirken auf mich beneidenswert selbstbewusst, klar, gelassen und heiter – alles Eigenschaften, die ich gern hätte. Stattdessen komme ich mir aber allzu häufig unsicher, ziellos und total konfus vor.
„The only way to become selfconfident, is to make experiences.”
Um selbstsicherer zu werden, musst du Erfahrungen machen.
Schon wieder so ein druckreifer Satz, den ich gleich heute Abend in mein Tagebuch schreiben werde…
Natürlich müsse man, um Erfahrungen zu machen, auch mal etwas riskieren, sagt Yussuf, aber das bedeute nicht, dass man sein Gehirn abschalten solle. Im Gegenteil, man sollte seinen Verstand schärfen und alles bedenken, was einem an Information zur Verfügung steht. Und sobald man eine Erfahrung – egal, ob eine gute oder schlechte – gemacht hat, sei es wichtig, sie gründlich zu analysieren und auszuwerten. Nur so könne man daraus lernen.
Es beginnt zu dämmern.
Inge und Ali kommen von ihrem Rundgang zurück, und die beiden jungen Männer laden uns ein, noch mit in ihre Wohnung zu kommen.
Ich bin sofort einverstanden; es interessiert mich zu erfahren, wo und wie die Zwei leben. Aber Inge zögert. Sie gibt zu bedenken, dass wir morgen nicht verschlafen dürfen und pünktlich um zehn Uhr beim 608 sein müssen, sonst würde Rolf ohne uns abfahren.
„Wir können uns vom Hostel wecken lassen,” wende ich ein, „außerdem macht es nichts, wenn wir völlig übernächtigt in den Bus klettern – wir können doch auch während der Fahrt pennen.”
Inge wirft mir einen zweifelnden Blick zu, und ich verstehe, dass die Sorge, wir könnten die Abfahrt unseres Busses verpassen, nicht der wirkliche Grund ihres Zauderns ist. Sie ist einfach unsicher, ob wir zwei jungen Türken, die wir gerade seit ein paar Stunden kennen, in deren Wohnung folgen sollten…
„Türkinnen würden so was bestimmt nicht machen,” meint sie.
„Aber wir sind keine Türkinnen,” stelle ich fest. „Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Die sind in Ordnung, die werden nichts machen, was wir nicht wollen.”
Inge zieht eine Grimasse: „Vielleicht ist genau das mein Problem – dass ich nicht wirklich weiß, was ich will und was nicht…”
„Don’t think too much about tomorrow – or yesterday!” ruft Ali fröhlich.
„You live right now – THIS IS WHAT’S HAPPENING!”
Inge lacht.
„Na gut, dann mal los… starten wir ein deutsch-türkisches Happening!”
Ali und Yussuf teilen sich eine Wohnung, die nur aus zwei winzigen, durch einen kleinen Flur verbundenen Zimmern besteht. Die Toilette befindet sich im Treppenhaus. In beiden Zimmerchen gibt es jeweils ein Bett, eine Kommode und ein Bücherregal – mehr würde auch nicht hinein passen.
Wir sitzen in Alis Zimmer auf dem Teppich, weil das einen Tic größer ist als das andere. Er studiert Kunst und zeigt uns stolz sein neuestes, noch nicht ganz vollendetes Werk.
Es erinnert mich an die gigantischen Gemälde aus der Sowjetunion und DDR, die ich schon immer extrem scheußlich fand. Jene „sozialistische Kunst”, die muskelbepackte Arbeiter-Helden zeigt, die sich in revolutionär-kämpferischen Posen einer roten Fahne oder Hammer und Sichel entgegen recken – nur dass das Bildformat hier weit bescheidener ist und dass die muskelstrotzenden Arbeiter mit ihren schwarzen Schnauzbärten eben sehr türkisch aussehen.

Aber das sage ich Ali nicht.
Es gibt auch Momente, da ist Offenheit fehl am Platze; dann nämlich, wenn sie absolut nichts bewirkt – außer, möglicherweise Jemanden zu verletzen.
Wir reden, trinken Tee, lachen. Es wird spät.
Einige Male versinkt mein Blick tief in Yussufs warmen, dunklen Augen.
Und als Inge schließlich meint, sie wolle nun wirklich langsam los, fragt er: „Why don’t you stay here tonight? I could bring you to your Hostel very early in the morning…”.
Ich bin unschlüssig.
Einerseits ist er ein kluger, attraktiver, einfühlsamer Mann, anderseits bin ich aber jetzt schon in einem Zustand geistiger und emotionaler Erschöpfung – zuviel habe ich heute gesehen, erlebt, gehört, gelernt.
So mache ich schließlich das, was er selbst mir heute Nachmittag geraten hat, ich verlasse mich auf meinen Instinkt.
Und der sagt mir, dass ich gehen und diese nur noch kurze Nacht allein in meinem Bett im Hostel verbringen sollte.
Yussuf und Ali bringen uns noch bis zur Uferpromenade am Bosporus, von wo aus Inge und ich den Weg zum Hostel kennen.
Es ist etwa so spät wie vor fünf Tagen, als ich nach unserer Ankunft nachts durch diese Stadt irrte, auf der Suche nach einem Platz zum Schlafen.
So vieles hat sich in diesen fünf Tagen geändert. Istanbul ist von einem finsteren Moloch zu einem faszinierenden, lebendigen Ort geworden, ich habe die Wahl zwischen zwei verschiedenen, aber gleichermaßen netten Schlafgelegenheiten, – und, ja, auch ich habe mich ein wenig verändert.
Zum Abschied hauche ich Yussuf einen Kuss auf die Wange.
„You,” sage ich leise, „you definitely touched my heart.”