1989 reiste ich ich mit Freunden und Kollegen, mit denen ich zusammen an der TU Berlin und in der Firma Teles arbeitete, nach Toronto um Kollegen von Nixdorf Kanada zu treffen, und weiter nach San Francisco, um an dem ODA-Workshop im IBM-Forschungszentrum Almaden teilzunehmen.
Kategorie: Uncategorized
Krieg in der Ukraine — geht er nie zu Ende?

Ein gerechter Frieden, aus dem alle Parteien erhobenen Hauptes hervorgehen und der absolute Verzicht auf Gewalt zur Durchsetzung von Gebietsansprüchen könnte dazu führen, dass auch Ukraine und Russland sich am Ende des Konflikts die Hände reichen. Ja, das ist vorstellbar, trotz aller Verletzungen und Opfer, die die Ukraine erdulden musste, und trotz des Wunsches nach Vergeltung für die russischen Soldaten, die in diesem Krieg gefallen sind, den die Verwandten der russischen Gefallenen zwar irrational, aber trotzdem irgendwie verständlich hegen.
Leider gibt es Kriegstreiber wie den ukrainischen Botschafter in Deutschland, der genüsslich verkündet, dass die Ukraine sich auch nach einem Friedensschluss natürlich die Krim zurückholen würde, sobald Russland irgendwie Schwäche zeigt.
Allerdings hat auch Deutschland 25 Jahre gebraucht, um zu akzeptieren, dass die Gebiete „jenseits von Oder und Neiße” nie wieder Teil eines deutschen Staates werden. (Natürlich hatte Deutschland diese Gebiete in einem von ihm angezettelten Angriffskrieg verloren, gerechterweise sozusagen, während der Donbaz und die Krim der Ukraine durch einen Angriff auf ihrem eigenen Territorium rechtswidrig weggenommen wurden, wodurch der Vergleich hinkt).
Versöhnung mit Putin?
Putin vereinigt das russische Volk hinter sich (und auch viele Russen und andere Menschen im Ausland) durch sein Narrativ, Russland stände alleine gegen den Rest der Welt, nur aus dem einen Grund, weil der Westen Russland wirtschaftlich und militärisch vernichten und unterwerfen will.
Dagegen steht das Narrativ des Westens, dass man nicht gegen Russland kämpft, sondern einer befreundeten Nation hilft, die von Russland unrechtmäßig auf dem eigenen Territorium angegriffen wurde. Diese Begründung für alle Hilfe des Westens für die Ukraine wird leider nicht im Entferntesten so einstimmig vorgebracht wie die russische Propaganda. Das schadet ihrer Glaubwürdigkeit.
Der erste Schritt von diesem Weg war bereits mit dem Satz des amerikanischen Präsidenten Biden gemacht, der auf Putin gemünzt sagte „Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben.“ Leider fügte er nicht hinzu „… wenn es zwischen Russland und Ukraine Frieden geben soll”, was das eigentliche Ziel des Beistands für die Ukraine wieder in den Mittelpunkt gerückt hätte. Auf diese Weise entstand der Eindruck, die Amerikaner verfolgten eine Destabilisierung Russlands und den Sturz seiner Administration mit Wirtschaftssanktionen und durch die Verlängerung des Ukrainekriegs als primäres Ziel, um … ja spätestens hier muss man sich ja fragen, welchen Grund die Amerikaner dazu haben sollten, außer einem tief verwurzelten Hass gegen alles, das aus dem Osten kommt (außer chinesischen T‑Shirts).
Als Nächstes sagte der unglückliche amerikanische Verteidigungsminister Austin, die Ukraine könne gewinnen, „wenn sie die richtige Ausrüstung und die richtige Unterstützung“ habe. Gewinnen und Russland unterwerfen — hat er das gemeint? Das ist absurd, wird aber natürlich gerne als Bedrohungsszenario zur Rechtfertigung der immer drastischeren russischen Kriegsführung aufgegriffen.
Zwar ist Austin nur Verteidigungs‑, nicht Außenminister, aber etwas Nachdenken über ein Ende des Krieges hätte auch ihm nicht geschadet, bevor er sich öffentlich äußert. Dann hätte er gewusst, dass eine Rückkehr zum Status quo ante, den Grenzen vom 23. Februar 2022 bei einer einvernehmlichen Regelung über die Administration der Gebiete unter russischer Besatzung und ein Korridor unter russischer Hoheit zwischen Donbaz und Krim (der fast zwingend die Stadt Mariupol einschließt) realistisch das Beste ist, das eine Friedenslösung erreichen könnte.
Wir müssen uns gegen die Kräfte wehren, die sich die Zerstörung Russlands auf die Fahnen schreiben, vor allem dann, wenn sie es als offizielle Haltung einer Regierung zum Ausdruck bringen, wie es in den USA, Großbritannien und leider auch gelegentlich auf ukrainischer Seite passiert.
Eine Erbfeindschaft, wie sie zu Kaiserzeiten zwischen Deutschland und Frankreich gepflegt wurde, um damit bei jeder passenden Gelegenheit einen Krieg vom Zaun zu brechen, ist anachronistisch, nicht nur, weil Kriege heute gefährlicher sind als je zuvor, sondern auch, weil sie keinen Raum für die Beendigung der Feindseligkeiten lassen.
Ein paar Gedanken zum Pflegenotstand

Neulich sprach ich mit meinem Sohn Robin über Wege aus dem Pflegenotstand. Seine Mutter ist Pflegekraft, also sind wir gewissermaßen Betroffene. Durch meine Arbeit im Betriebsrat eines Krankenhauses und die damit verbundenen, vielen Gespräche habe ich etwas Einsicht in die Probleme gewonnen.
Anders als viele annehmen, ist Geld nicht das primäre Problem. Pflegekräfte auf einer Intensivstation verdienen relativ gut, abhängig vom Arbeitgeber, vor allem, wenn sie einige Jahre Berufserfahrung haben. Bei den Kollegen auf den peripheren Stationen ist sicher mehr Luft nach oben.
Zwei Dinge würden meines Erachtens wirklich helfen, die bisher überhaupt nicht oder nicht ausreichend thematisiert wurden.
Das Berufsbild muss sich so ändern, dass dem Pflegeberuf mehr Verantwortung und mehr Handlungsoptionen übertragen werden. Die Ausbildung muss entsprechend angepasst werden, sodass Pflegekräfte auf Augenhöhe mit den behandelnden Ärzten in der Behandlung der Patienten zusammenarbeiten können, wie es in anderen Ländern üblich ist. In manchen Kliniken ist das bereits der Fall, aber noch nicht ausreichend. Durch die Aufwertung des Berufsbildes wird der Beruf attraktiver für junge Leute, was wiederum mittelfristig zu mehr Berufsanfängern führt. Die Reihen könnten sich so in ein paar Jahren wieder füllen.
Zweitens muss man einsehen, dass nicht alle einen Beruf, der körperlich und psychisch so anstrengend ist, bis zum Rentenalter ausüben können. Im Moment sieht man das besonders deutlich, weil es mehr ältere Pflegekräfte als junge gibt. Das ist Demografie und nicht zu ändern.
Ältere Pflegekräfte berichten, dass die Arbeitsteilung früher besser funktioniert hat als heute. Körperlich schwere Arbeiten haben eher die jungen Pflegekräfte übernommen und man konnte jemanden dazu rufen, wenn Not am Mann war. Pflegekräfte über 50 wurden vielfach nicht mehr oder zu weniger Nachtdiensten herangezogen, wie es der Arbeitsschutz empfiehlt. Das alles ist durch Demografie und die knappen Besetzungen der Dienste nicht mehr möglich. Hier muss eine Perspektive geschaffen werden, die es erlaubt, früher auszusteigen oder in weniger belastende Tätigkeiten zu wechseln.
Von Fluglotsen und Piloten sind solche Modelle bekannt. Bei den Pflegekräften geht es um ein paar Nasen mehr, hier muss mehr Geld in die gesetzliche Alterssicherung fließen (nicht nur in die Taschen der Betroffenen), um einen früheren Einstieg in die Regelaltersrente ohne Abschläge zu ermöglichen, denn es gibt nicht für alle Älteren weniger belastende Tätigkeiten, in die sie wechseln könnten. Selbst viele junge Leute können sich heute nicht vorstellen, den Pflegeberuf bis zur Regelaltersgrenze auszuüben. Unter der Belastung reduzieren viele ihren Arbeitszeitanteil und gehen mit weniger Geld nach Hause — und da geht es nicht um die viel beschworene Work-Life-Balance! Das Licht am Ende des Tunnels ist einfach zu weit weg.
Pflegenotstand — kein Ende in Sicht
Im Betriebsrat in dem Krankenhaus, in dem ich zur Zeit arbeite, gerieten wir kürzlich wieder einmal in eine heftige Debatte über die Gründe für den Mangel an Pflegekräften und über Möglichkeiten, diesen Mangel zu beseitigen. Ausgelöst wurde sie durch eine Mitbestimmungsanzeige für zwei Pflegekräfte aus Bosnien-Herzegowina, die auf der Intensivstation die Arbeit aufnehmen sollten.
Im Grunde genommen ist die gegenwärtige Gewinnung von Pflegekräften — wie im übrigen schon seit langem — unethisch, weil sie auf Kannibalisierung beruht. Es ist ein gutes Zeichen, dass es uns wütend macht, denn es ist falsch und muss bekämpft werden.
Die Kannibalisierung geht national und international vonstatten. Es ist nämlich kein Zeichen von wunderbarer internationaler Zusammenarbeit, dass man die Grenze zu Tschechien nicht schließen kann, weil dann in Bayern Ärzte und Pflegekräfte fehlen (und Arbeitskräfte bei Autobauern und ‑zulieferern), sondern eine aggressive und zerstörerische Ausbeutung der Ressourcen unserer europäischen Nachbarn. Hat sich denn nie jemand gefragt, wer in Serbien, Albanien, Bosnien-Herzegowina, in Tschechien und in Polen — um nur ein paar Beispiele zu nennen — kranke Menschen behandelt und pflegt? Wie diese Länder es verkraften, dass die Menschen ihnen den Rücken kehren, sobald sie gut ausgebildet sind? Was das für die Zukunft dieser Länder bedeutet? Offenbar haben wir uns so sehr an diesen sehr einseitigen „Austausch” gewöhnt, dass wir nichts Anrüchiges daran finden können. War das nicht immer schon so? Kommen Krankenschwestern nicht schon immer von weit her, aus Vietnam und aus Polen? Hat man sich nicht mittlerweile daran gewöhnt, dass der Arzt den Patienten nicht gut versteht, weil er dessen Sprache nur lückenhaft spricht?
Ausweisungen und das Recht auf Asyl

Quelle pxhere.com
Es gibt viele Gründe, mit der Einwanderungspolitik und der Asylgewährung hierzulande unzufrieden zu sein. Das größte Unbehagen bereitet mir die fehlende Bestimmtheit bei den Verfahren, die regeln, wer bleiben darf und wer gehen muss.
Die Entscheidung über ein Asylgesuch und über das Bleiberecht, wenn keine formalen Asylgründe vorliegen, wird in der Bundesrepublik weitgehend in einer rechtlichen Grauzone nach persönlichem Ermessen von Sachbearbeitern getroffen. Der Rechtsweg steht zwar grundsätzlich jedem offen, dessen Ersuchen abschlägig beschieden wird. Aber ein schlechtes Verfahren wird nicht besser, weil ein Richter es überprüfen kann. Im Gegenteil, auch der Richter stützt sich bei seiner Entscheidung auch auf die im Asylverfahren erhobenen Erkenntnisse und kommt daher fast zwingend zum gleichen Ergebnis.
Ein Problem dabei, von dem immer wieder berichtet wird, sind die Dolmetscher, die großen Einfluss darauf haben, was in den Akten festgehalten wird. Wenn der Übersetzer aber aus ethnischen oder religiösen Gründen, oder weil er einfach dem Herkunftsstaat gegenüber loyal ist, dem Asylsuchenden nicht wohlgesonnen ist, kann er dessen Einlassungen verfärben oder verfälschen, ohne dass das leicht zu entdecken ist. Das geschieht tagtäglich, nicht nur in Einzelfällen.
Asylsuchende erleben die Prüfung ihres Antrags oft als einen Akt der Willkür und die Obrigkeit als in ihrem Handeln ohne Regeln und Kontrolle von Gefälligkeiten und Gehässigkeiten gesteuert — nicht anders, als sie es oft aus ihrem Herkunftsland gewohnt sind. Die Bundesrepublik muss ihnen als Willkürstaat erscheinen, in dem Recht und Gesetz nicht präsent sind, was sich gelegentlich — ohne das entschuldigen zu wollen — auf die Compliance des Asylsuchenden überträgt.
Für Asylsuchende und für die Menschen im Lande ist es jedenfalls zermürbend, wenn Ausweisungen damit begründet werden, die Betroffenen seien „Gefährder und Straftäter”, ohne dass man sich dessen sicher sein kann, dass diese Einordnungen in jedem Einzelfall rechtsstaatlichen Kriterien genügt. So sind Zweifel begründet, dass nur solche Personen in ihr Herkunftsland zurückgeführt werden, bei denen man bei verständiger Würdigung zu dem Ergebnis kommen muss, dass sie dem Asylland und seinen Bürgern Schaden zufügen werden. Wenn aber Menschen, die ihrem Gastland wohl gesonnen sind, durch die Rückführung in ihr Herkunftsland einem Risiko von Verfolgung, Folter und Tod ausgesetzt werden, so ist das besonders tragisch. Ob man im Gegenzug hinnehmen will, dass Personen einem solchen Risiko ausgesetzt werden, die dem Asylland schaden, ist ein weites Feld der Debatte, das schließlich in der Frage mündet, ob Leben und Gesundheit jedes Menschen hier und heute tatsächlich unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung stehen.
Da es immer wieder um Leben und Gesundheit des einzelnen Asylsuchenden geht, besteht ein dringender Bedarf, das Asylverfahren rechtssicher durch Gesetze festzulegen und der Grauzone der Unsicherheit und des persönlichen Ermessens zu entreißen. Hierzu gehört auch die Festlegung, wann Personen hier bleiben dürfen, deren Asylgesuch abgelehnt wurde. Rechtssicherheit in diesen wichtigen und kontrovers diskutierten Fragen ist sicher keine unbillige Erwartung gegenüber einem Rechtsstaat.
Die Verfahren zur Gewährung des ALG II kann man übrigens unbedenklich mit gleicher Elle messen, obwohl es da „nur” um staatliche Leistungen geht, nicht um Leben und Tod.
Ärzte ohne Grenzen
Spiegel und Handelsblatt feiern ein Start-up, dass mittels Apps Deutschland aus dem Mittelalter in die digitale Neuzeit katapultieren soll.
Das ist genauso lächerlich, als würde ein Informatiker eine Hausarztpraxis aufmachen, weil er selbst gelegentlich seine Wehwehchen erfolgreich therapiert hat — mit dem Unterschied, dass Gesetze und Standesordnung das nicht zulassen. Diesen Ärzten sollte man Grenzen ziehen und sie anhalten, das zu tun, wofür sie ausgebildet sind und nicht die Welt mit Apps zu beglücken, die industriellen Maßstäben von Ergonomie, Datenschutz und Datensicherheit, Softwaredesign, Schnittstellen- und API-Design einfach in keiner Weise standhalten.
Kardiologen scheinen für diese Art von Hybris genetisch anfällig zu sein, die sie glauben lässt, sie wäre zu allem befähigt, weil sie Ärzte sind. Leider gibt es bereits mehrere Ärzte, die mit ihren Lösungen durch die Lande tingeln und den einen oder anderen Klinikchef davon überzeugen, gegen den erbitterten Widerstand (oder ohne die Kenntnis) der IT-Abteilung, die diese Software warten und Anwender bei deren Bedienung unterstützen muss.
Der Mythos der Garagenfirmen, aus denen milliardenschwere Softwareunternehmen entstanden sind, ist zum Teil so missverstanden worden, dass jeder Besitzer einer Garage eine Softwarefirma gründen und groß machen kann. Ausschlaggebend war in allen Fällen jedoch nicht die Garage, sondern unternehmerischer Geist und eben die technische Ausbildung, diese Dinge zu tun.
Durch das Krankenhauszukunftsgesetz wird aktuell massiv Geld in das System gepumpt. Das hat Geier und Blender auf den Plan gerufen, die ihre Berechtigung daraus beziehen, dass sie wissen, wie man die Verwaltung für dumm verkaufen und bezirzen muss, um an diese Fördertöpfe zu kommen. Ausgegeben wird das Geld danach, wer als Anbieter sich rechtzeitig in die Pole-Position gebracht hat und was ins Budget passt. Einen Masterplan, wie das Zusammengekaufte (oft nur Vaporware, von der ein schicker Mock-Up existiert) zusammenspielen soll, ist weder Voraussetzung noch in den Beratungsleistungen eingeschlossen (warum sollte man auch etwas tun, wofür es kein Geld gibt). Somit ist das Krankenhauszukunftsgesetz ein schönes Beispiel von einem naiven guten Vorsatz, der am Ende nur dazu führt, dass Steuergeld unters Volk kommt. Denn dessen können wir gewiss sein: das Geld ist nicht weg, es hat nur ein anderer.
Mietendeckel-„Irrsinn”?
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) ist „in Sorge” über die Auswirkungen des Berliner Mietendeckels, Leser des Tagesspiegels sehen Berlin von Sozialisten regiert. Der Tagesspiegel macht richtig Stimmung.
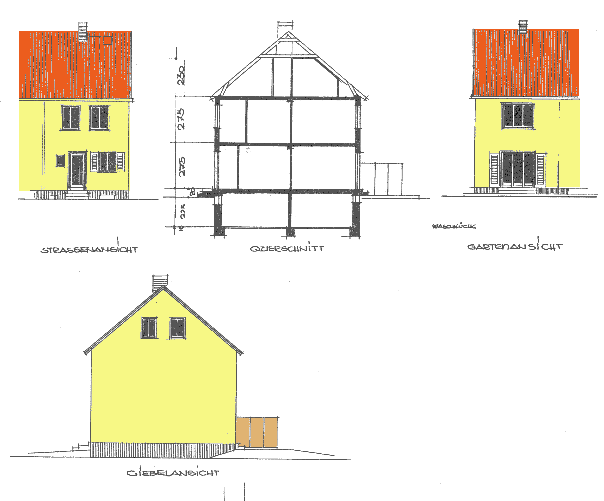
„Angebot an Wohnungen halbiert” — „Mietendeckel hat dramatische Auswirkungen”
Sicher kann man festhalten, dass viele Berliner erheblich weniger Miete zahlen als vor dem Mietendeckel. Obwohl die Zahlen nicht richtig belastbar sind, überrascht das Momentum der Maßnahme offenbar selbst deren Urheber. Wegen der ausstehenden Gerichtsentscheidung über die Rechtmäßigkeit der Maßnahme geben viele das Gesparte noch nicht aus, sondern legen es als Sicherheit auf die hohe Kante.
Weg ist das Geld nicht — es hat eben nur jemand anderes, und das ist gut so.
Angebot halbiert? Da reibt man sich Augen: steht die Hälfte der Wohnungen leer? Nein, auch wenn das gelegentlich öffentlichkeitswirksam behauptet wird — durch den Mietendeckel wird es nicht attraktiver, Wohnraum leerstehen zu lassen.
Hohe Mieten waren bisher für viele ein Grund, umzuziehen und haben damit auf dem Wohnungsmarkt für Bewegung gesorgt. Jeder Mieter fragt sich regelmäßig, ob er monatlich ein Drittel bis die Hälfte seines verfügbaren Einkommens dafür aufbringen will, dass er oder sie ein Dach über dem Kopf hat. Die Begüterten bauen oder kaufen selbst, die weniger Begüterten schauen, ob man nicht woanders für weniger Geld mehr Wohnqualität bekommt. Zahlungskräftigere Bewerber rücken nach. Hohe Mieten halten auf diese Weise ein unproduktives Umzugs- und Verdrängungskarussell am Laufen. Wenn das Karussell sich langsamer dreht, ist das Angebot nicht mehr so groß — das ist wahr, es bedeutet aber auch, dass die Verdrängung von nicht so zahlungskräftigen Mietern aus attraktiven Wohnlagen, bekannt als Gentrifizierung, an Tempo verliert.
Ich bekenne, dass ich selbst Wohnraum vermiete, übrigens zu einem erheblich geringeren Preis als vor dem Mietendeckel. Obwohl ich also Einbußen habe, bin ich mit der gesetzlichen Schaumbremse für den überhitzten Wohnungsmarkt einverstanden. Die Sorge um die Bezahlbarkeit der eigenen Wohnung ist durch die Maßnahme vielen genommen worden, das ist gut so.
Vor 20 Jahren übernahm der „relative Newcomer” Google Deja’s Usenet Newsgroup Service
Ich glaube nicht an KI
Zu dem Artikel auf heise.de https://www.heise.de/news/Ursula-von-der-Leyen-Ich-glaube-an-die-Kraft-von-KI-5046668.html

Quelle: CC-BY‑4.0: © European Union 2019 – Source: EP
KI ist nichts Magisches und Abstraktes, an das man nur glauben kann, weil es nicht greifbar ist. Künstliche Intelligenz ist ein Oberbegriff für Mechanismen, die Entscheidungen, die immer gleich fallen, automatisch vorwegnehmen. Wo Sachbearbeiter nur Richtlinien anwenden, auf die sie selbst keinen Einfluss haben, oder Ärzte Therapieentscheidungen treffen, ohne den Patienten gesprochen oder gesehen zu haben, ist nichts daran auszusetzen, dass Software Entscheidungen vorwegnimmt, die immer gleich fallen, und damit den Prozess beschleunigt.
Wenn der Mensch gelegentlich Fehler macht, weil er die Vielzahl von Parametern nicht mehr überschauen kann, z. B. wenn er nicht alle Parameter betrachtet oder willkürlich abwägt, kann die Prozessqualität gesteigert werden, wenn die Regelwerke der Entscheidungsgrundlage formalisiert und der Prozess selber automatisiert wird.
Google stellt nicht so viele Frauen ein. Bei einem Testlauf hat die AI beim Google Recruiting deshalb Bewerbungen von Frauen bereits im Vorfeld aussortiert. So verstärkt AI negative Tendenzen, denn bei aller Intelligenz fehlt ihr die Fähigkeit zur kritischen Reflexion.
Sing Bach!
Zehn Brandenburger Singklassen üben vier Tage auf Schloss Boitzenburg für ein öffentliches Konzert in Schwedt.
Brandenburger Singklassen


































