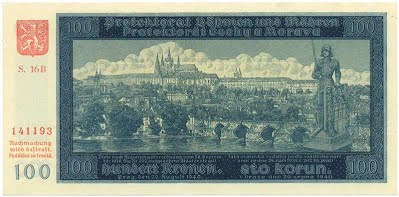Der nächste Morgen ließ sich freundlich an. Maria lag noch müßig in Bett, während ich mich fertigmachte. Mit unverbindlichen Worten redeten wir über das am Abend Gesagte hinweg. Mir selber schien es fast wie ausgetilgt, wie ein Spuk der Nacht. Vage erhob sich in mir die Hoffnung, auch Maria könnte ihre Übereilung bereuen, das Zugesagte zurücknehmen und den gestrigen Tag auslöschen. Als ich, mit dieser Hoffnung, allein die Treppe hinunterging, nährte ich sie, hegte sie und spann sie aus, bis sie mir zur Gewissheit geworden war.
Ich betrog mich selbst, denn nur so konnte ich nur unbeschwert fortgehen, jetzt, in diesem Stadium des Anfangs und der Unentschiedenheit — „Principiis obsta!” musste ich denken — wenn ich mich mit dieser Hoffnung, dieser Gewissheit tröstete. Sonst hätte ich bleiben müssen, sogar auf die Gefahr hin, eine Vorlesung zu versäumen, hätte reden und argumentieren und kämpfen müssen. Vielleicht hätte ich alles noch abwenden und umbiegen können, wäre ich an diesem Morgen nicht so leichtherzig die Treppen hinuntergesprungen, immer zwei Stufen auf einmal, dazu ein Lied summend, das ich eben im Nachbarzimmer hatte singen hören, in meinem Innern bastelnd an der durchaus ungewissen Hoffnung, dass Maria schon das Klügere tun werde.
Ich dachte nicht daran, dass man Klugheit in diesem Augenblick nicht von ihr erwarten durfte, dass es meine Sache hätte sein sollen, sie von einem Fehler abzuhalten. Aber dann wieder sagte ich mir, dass hier ja ganz anderes am Werk war, als ich dachte und wusste, und dass ich am Ende doch nichts hätte ausrichten können, auch wenn ich dageblieben wäre und all meine Überredungskünste aufgewendet hätte …
Ich hörte meine Vorlesung im Zeitungswissenschaftlichen Institut am Obstmarkt. Dann saß ich wieder über mein Gedicht gebeugt. Die ganze Stadt draußen hatte sich zum Frühling entschlossen. aber nur wenig drang davon in die Moderluft der Institutsräume.
Die Innenseite der Natur belebt sich,
verheimlichend ein neues Freuet-Euch.
Ganz vernünftig konnte ich jetzt wieder über die Zeilen räsonieren. Es fiel mir jetzt auch ein, dass das alles ja nicht das war, was ich an Tage vorher gesehen hatte. Nichts war gesagt von den Bildern des Frühlings. Der Dichter schlüpfte ja ins Innere von Baum und Busch und Erde, verschwand im Unsichtbaren und Abstrakten. Oh ja, das war eine gute Idee. Ich prüfte sie nach, baute sie aus, bewies sie, knetete daran herum, bis sie tatsächlich mehr als eine ganze Seite bedeckte.
Dann machte ich mich daran, die Anspielung auf Weihnachten, das anachronistische „Freuet-Euch” zu zerpflücken, das ich, im Anerzogenen verharrend, absurd und respektlos finden musste. Das brachte mich auf den Gedanken, dass Rilke auch manches dem Reim zuliebe getan haben könnte. Ja, durchaus, hier schien es, als hätte sich etwas auf Gesträuch reimen sollen, und was reimt sich schon auf Gesträuch? Zwar folgte „Gesträuch” erst zwei Zeilen später, aber was besagte das schon? Der Dichter würde ja wohl sein Gedicht nicht der Reihe nach hersagen wie ein Schulkind.
Ich fand Spaß an der Sache. Der Gedanke mit den Reimen gab zwar nicht viel her, da die anderen Reime alltäglich waren. Aber als es zwölf schlug, war ich zufrieden mit mir und steckte das Blättchen in die Tasche. Im Hausflur drückte ich auf die Klingel für das Musikwissenschaftliche Institut: lang-kurz-lang-kurz. Für einen Augenblick lang kam es mir unrecht vor, dass ich Lindes Morsezeichen benutzte und mich damit fast für sie ausgab.
Als Hartmut herauskam, war er allerdings erstaunt, nur mich zu finden und nicht Linde, aber er war nicht verstimmt, und so machte ich mir weiter nichts draus. Wir entschieden uns für die Vegetarna in der Zeltnergasse und gingen eine Weile schweigend. Dann sagte Hartmuth:
„Der Wiggert hat eine neue Flamme.”
„Ich weiß”, sagte ich, beschämt, weil ich diesen Schrecken schon fast vergessen hatte. „Ich habe sie zusammen gesehen.”
„Ich auch”, erwiderte Hartmuth. „Und Linde auch. Er hat sie uns vorgestellt. ‚Da habt ihr die Frau meines Lebens’, hat er gesagt — so ein sentimentaler Quatsch! Musste er das sagen — vor Linde?”
„Ich fürchte, er hatte keine Ahnung, was er sagte”, erwiderte ich. „Ich glaub’, er hat keine Ahnung, was das der Linde bedeutet.”
„Aber sie hat Linde angeschaut, als wär’ die sowas wie eine abgelegte Geliebte. Ich glaube, die Linde hat noch keinen Bissen gegessen seitdem! Das war gestern!”
„Wir sollten sie abholen, unbedingt!”
„Nein, lass nur. Sie muss damit fertig werden, allein. Reden hat keinen Sinn.”
Wir kamen zur Vegetarna und stiegen die Treppen hinauf. Am Fenster war ein Tisch frei. Wir lasen die Speisekarte, wählten und bestellten. Dann war es lange still. Plötzlich sagte Hartmuth:
„Ich frage mich manchmal, ob in anderen Städten die Dinge anders laufen und anders ausgehen als hier. Die Stadt ist so mächtig, sie lässt nur zu, was ihr gemäß ist. Als ob man nur sie lieben dürfte, als ob sie alle andere Liebe mit Eifersucht verfolgte -”
„Und ist die Stadt nicht eine solche Liebe wert?” fragte ich.
Er hob das Gesicht aus den Händen und verschränkte sie vor dem Munde.
„Ja”, sagte er, „doch — vielleicht. Ich habe es mir nie überlegt. Nur, alt dürfte man hier nicht werden.”
Die Serviererin brachte die Dukatenbuchteln in der sahnegelben Vanillesauce, und wir stachen mit der Gabel in das knusprige Gebäck.
Als ich am andern Morgen aufwachte, war Maria schon im Gehen. Ich lag still und hielt die Augen geschlossen, bewusst, dass ich mich verstellte, bewusst, dass ich etwas fragen, etwas sagen sollte, denn wir hatten uns auch am Abend vorher nicht mehr gesprochen. Aber ich schwieg und blieb liegen wie im Schlaf, blieb auch eine Weile noch so, als sie schon gegangen war, wartend, ob sie etwa noch einmal zurückkäme, weil sie etwas vergessen hatte, wie es manchmal vorkam.
Der Gedanke war mir entsetzlich, dass sie ging, um den Pockennarbigen zu treffen, als Buße dafür, dass sie ihren Mann nicht lieben konnte. Aber wie sollte ich mit Worten etwas daran ändern? Es war mir zu fremd, ich schob es weg und versuchte zu vergessen.
Im Waschraum stand wieder, das Haar über den langen Rücken hochgetürmt, Ellen Brand beim Waschen. Richtig, wir gingen ja in die gleiche Vorlesung, mussten zur gleichen Zeit uns fertigmachen. Aber sie war heute nicht gesprächig, beeilte sich auch ungewöhnlich, so schien es mir. Ich meinerseits aß nur im Stehen ein Brot, um eine Bahn früher zu erreichen, mit der sie nicht fahren würde. Wie ich schon anfing, andern aus dem Wege zu gehen — es wunderte mich selber. Aber es schien mir, ich dürfte mich nicht in zu viele fremde Kreise fangen lassen, wenn ich überhaupt zu mir selber kommen wollte.
Als ich im vorderen Wagen meiner Bahn stand, sah ich, wie auch Ellen Brand noch in letzter Sekunde auf die hintere Plattform sprang. Es sah ja aus, als hätte auch sie mir aus dem Wege gehen wollen. Einen Augenblick lang überlegte ich, was dafür wohl der Grund sein könne, aber dann dachte ich der Sache nicht weiter nach, sondern genoss wieder, wie jeden Morgen, die sausende Fahrt talwärts durch die Schlucht von Mietshäusern, die dann plötzlich zurückwich und sich ausweitete zum Karlsplatz, Vorbote der eigentlichen und wirklichen Stadt, die sich zu beiden Seiten der Bahn ausbreitete.
Der Platz war über Nacht ergrünt und lebendig geworden. An Büschen und Bäumen faltete sich’s auf, dehnte sich aus in die Weite und Breite und spann hin und her, nach rückwärts und vorwärts, sein grünes Gespinst zwischen Rathaus und Denkmälern und dem barocken Säulenportal der Ignatiuskirche. Leben überwucherte dieses riesige Geviert toter Sehenswürdigkeiten. Hier und da blühte es auch schon mitten im Grünen.
Ich beugte mich aus der offenen Tür, eben da die Bahn wieder anfuhr. Es roch nicht nach Frühling, merkwürdigerweise, sondern nach Rauch. Aber noch merkwürdiger war, dass auch in diesem Geruch von Holzfeuer der Frühling war, nicht süß und doch lockend, nicht einschmeichelnd und doch verführerisch. Herb, kräftig, fast bitter strömte es her über den Platz; aus vielen Fernen schien es herzukommen, weit in viele Fernen hinauszurufen.
Die Bahn hatte ihre brausende Talfahrt wieder aufgenommen, sie riss uns alle vorwärts und nach unten. Ich stand neben dem Fahrer und sah ihn plötzlich hastig hantieren. Ein Schreck durchzuckte mich: es war offensichtlich, dass er die Gewalt über die Bremsen verloren hatte. Da unten, am Ende der Strecke, floss breit und gelassen die Moldau. Wenn es ihm nicht gelang, den Wagen in der Kurve herumzureißen, würde das leichte Geländer kein Hindernis sein und der Zug würde mit allen seinen Fahrgästen in den Fluss stürzen. — Ich wagte nicht, dem Fahrer ins Gesicht zu sehen; wie gebannt starrte ich nur voraus in die Tiefe, in die es uns vorwärts und hinabriss mit der Gewalt von Eisen und Stahl. Entsetzen schnürte mir die Kehle zu, ich fasste nach dem Griff der Tür.
Die Kurve kam rasend schnell heran; es riss den Wagen zur Seite, dass ich glaubte, er müsse aus den Schienen springen, aber die Weiche hielt, leitete ihn im Bogen hinein in seine vorgesehene Bahn.
Erst jetzt wagte ich, dem Fahrer ins Gesicht zu sehen. Schweiß rann an den Schläfen herunter durch die tiefen Furchen in der grauen Haut. Wir waren allein auf dem Perron.
Er murmelte ein paar tschechische Worte ohne mich anzusehen, aber ich verstand sie nicht. Erst an der nächsten Haltestelle, am Nationaltheater, zog er sein Taschentuch und wischte den Schweiß von der Stirn. Mit ängstlichem Lächeln sah er endlich zu mir her. Ich lächelte auch.
„Wir haben Glück gehabt”, sagte ich. Obwohl ich nicht wusste, ob er meine Worte verstand, war ich doch sicher, dass er wusste, was ich meinte. Das Lächeln erlosch jetzt auf seinem Gesicht, er bewegte die Lippen, als habe er etwas Wichtiges zu sagen, aber dann läutete es von hinten aus dem Wagen, der Polizist winkte von der Kreuzung vorn, und der Wagen setzte sich wieder in Bewegung. An der Moldaulände hin glitt er jetzt, vorbei an den hohen spiegelnden Scheiben der Kavarnas, hinter denen man Müßiggänger im Sessel lehnen sah bei Kaffee und Zeitung — für sie wäre es nur eine Notiz im lokalen Teil gewesen, vielleicht auch zweispaltig aufgemacht oder höchstens dreispaltig, je nachdem, wie viele Menschen dabei zu Tode gekommen wären. Aber mir, die es in Angst durchlebt hatte, schien es, als verberge sich hinter diesem Vorkommnis etwas Größeres, Allgemeineres, das ich noch nicht erkannt hatte. Mit Maria hatte es zu tun und ihrem Schrei in der Nacht, mit dem, was sie mir auf dem Jahrmarkt gesagt hatte und was mir doch immer hinter halben Worten verborgen geblieben war.
Ich sah die Linden grünen draußen am Moldauufer, sah die Tulpenbeete in den Anlagen flammen wie Feuer, sah Burg und Dom aufsteigen hoch über den Strom. Aber das alles war nur äußerlich. Was geschah wirklich, das viel wichtiger war und doch vor unseren Augen noch verborgen war? Ich hätte alle Menschen danach fragen mögen, und doch schreckte ich im Innersten davor zurück, wie die Leute im Wagen bei der rasenden Fahrt sich vor der Gefahr verborgen, sich zugeredet hatten, es gehe alles mit rechten Dingen zu, diese Leute, die jetzt lebten und weiterleben würden, ohne zu wissen, dass sie ihr Leben nur einem glücklichen Zufall verdankten.
Ganz gegen meine Gewohnheit saß ich heute viel zu früh auf meinem Platz im Hörsaal drei und zeichnete gedankenlos Blumen und Schnörkel auf ein leeres Blatt, während der Saal sich füllte. Der Platz drei Bänke vor mir, weiter links drüben, blieb vorläufig leer.
Es ereignete sich aber an diesem Tage wieder wie am Freitag vorher, dass Felix Erlach mit einem nicht geringen Aufwand an Geräuschen den Hörsaal drei erst betrat, als Professor Malon sich schon von seinem Einführungssatz davontragen ließ wie von einem wohlgefälligen Gewässer. Um genau zu sein, es ereignete sich von da an jeden Dienstag und Freitag mit der größten Regelmäßigkeit und nur mit einer einzigen Ausnahme, dass Felix Erlach in liebenswürdigem Eifer — man hätte auch sagen können, mit sanfter, aber entschiedener Aufsässigkeit — hinten ums Geviert der Bänke herummarschierte, wobei die Fußbodenbretter niemals versäumten, zu diesem Gange alle Schattierungen von Gekreisch und Geknarr beizusteuern, die schlecht und lose sitzenden Brettern von Natur aus eigen sind.
Ich hatte Gelegenheit, dies genau zu beobachten, denn nur zweimal versäumte ich diesen melodramatischen Auftritt, und nur einmal zollte ich ihm nicht die gebührende Aufmerksamkeit.
Ganz anders Professor Malon. Weder versäumte er den Auftritt jemals, noch ließ er es jemals an Aufmerksamkeit dafür fehlen, genauer gesagt, an einer unverkennbaren Missbilligung, die sich immer weiter steigerte, bis sie ihr plötzliches Ende fand.
Dies mochte umso stärker der Fall sein, weil sein Schüler und Jünger trotz des löblichen Eifers, mit dem er sich jedes mal einfand — in mehr als letzter Minute — es doch an Respekt vor der Philosophie, der Krone der Wissenschaften, empfindlich fehlen ließ. Malon, der von seinem Pult in den Saal sah, konnte als Einziger beobachten, dass die Störung mit dem eindrucksvollen Auftritt und Umgang, ja, selbst mit dem Vorbeizwängen an mehreren unwilligen Kommilitonen noch keineswegs ein Ende, sondern im Gegenteil, erst ihren Anfang nahm.
Denn ehe der Schuldige, aber durchaus nicht Schuldbewusste, sich setzte, die Bügelfalte seiner Hose hochzupfend, wandte er sich jedes mal nach rechts, drei Bänke zurück, zu dem Platz, wo ich saß. Er befand sich gerade am äußersten Ende meines Blickfeldes, so dass ich diese Wendung auch wahrnehmen konnte, ohne dass ich seinem prüfenden Blicke jedes mal hätte begegnen müssen. Ich muss freilich sagen, dass ich den allgemeinen Aufruhr und die vorwurfsvolle Pause, die Professor Malon zu diesem Zeitpunkt gewöhnlich einlegte, immer ausnutzte, mich beiläufig nach dem Störenfried umzusehen und seinen Blick zu erwidern, bevor ich mich eilig wieder meinem Heft zuwandte, so dass er sich nicht zu viel darauf einbilden konnte. Ich gebe aber zu, dass der Blick dieses schüchternen jungen Mannes mich beglückte.
Denn schüchtern, dachte ich, musste er ja wohl sein. Warum sonst dieser lärmende, aufwändig inszenierte Umweg zu einer so fragwürdigen und unsicheren Begegnung der Blicke? Warum setzte er sich nicht einfach neben oder hinter mich?
Aber es gefiel mir, dass er schüchtern war oder jedenfalls sich diesen Anschein gab. Hätte er sich frech und aufdringlich neben mich gesetzt, das Ganze hätte bald seinen Zauber einbüßen müssen. Und im Übrigen benahm sich dieser schüchterne junge Mann auch durchaus nicht schüchtern. Ich brauchte, wie gesagt, meinen Blick gar nicht zu wenden, um zu bemerken. wie immer wieder im Verlauf einer solchen Dreiviertelstunde sein Kopf sich rückwärts wandte, als müsste er sich vergewissern, dass ich auch unterdessen den Saal nicht verlassen hätte.
Hätte ich seine Blicke ebenso oft erwidern wollen, wie ich sie empfing, es wäre eine Unmöglichkeit daraus geworden. albern geradezu. Aber es genügte mir schon — und auch ihm offenbar — dass ich sie bemerkte, sie sozusagen heimlich in Besitz nahm, als mir gehörig, und im Laufe des Semesters wahrhaftig einen kleinen Schatz davon speicherte.
Niemand würde mir wohl glauben, wenn ich behaupten wollte, dass ich diese Blicke alle ungesehen hinnahm, sie unbesehen einsackte, sozusagen wie man Geld von einem Freund annimmt, der einen gewiss nicht betrügen wird. Natürlich erwiderte ich sie ab und zu, versuchte aber mehr oder weniger, meine Antwort beiläufig erscheinen zu lassen, indem ich den Blick zur Fensterreihe weiterwandern ließ oder von ihm fort ins Leere.
Es waren höchst merkwürdige Blicke, die auf solche Weise ausgetauscht wurden, nicht zu vergleichen mit denen, die sonst zwischen Mann und Frau unbewachterweise hin und hergehen, zwei Unbekannten, die das Ziel der Bekanntschaft nahe vor sich haben. Aber unter dem seidigen Gewebe des philosophischen Diskurses, gefiltert, geklärt und doch nicht zerstört, begab sich alles ganz langsam und gedämpft, etwas blutlos vielleicht, wie man eben die Fäden einer Idee hin und her webt, um dann am Ende zögernd zu prüfen, ob das Gespinst dem Tageslicht und der täglichen Beanspruchung auch genügen wird.
An diesem Dienstag fühlte ich das Weben der Fäden noch unwiderstehlicher als am Freitag vorher. Jeder Blick war wie ein schwacher Einstich in meine Haut; er verletzte mich auf eine so tröstliche und beruhigende Weise. Ich wurde fortgezogen von all den Schwierigkeiten, die ich getürmt sah auf allen Seiten, fortgezogen ins Einfache und Natürliche.
Ich kannte die Liebe noch nicht. Die Einzelheiten, aus Büchern zusammengelesen, verloren hier ihre Bedeutung. Dies hier kam mir ganz anders vor als alles, was in Büchern stand. Wie alle, die lieben, dachte ich, für mich müsste es anders sein, nicht platt, nicht banal. Ich wusste, dass es so nicht sein konnte. Aber wie es sein sollte …?
Ohne den Kopf zu wenden, warf ich einen raschen Blick hinüber. Wie schön sein Hinterkopf gewölbt war! Ich würdigte das umso mehr, da es mir selber an dieser Wölbung fehlte und an dem, wie man sagt, damit verbundenen Talent zur Mathematik. Auch die Stirn floh nicht zurück, angenehm rundete sie sich hinauf zu dem hohen Ansatz von dunklem Haar. Vergnüglich und nicht ganz ideal war nur die Nase: man konnte die Zeichnung des Nasenloches sogar von der Seite erkennen, eines sehr langen und fast ein wenig ins Gesicht zurücklaufenden Nasenloches, einem Schnepfenschnabel nicht unähnlich.
Obwohl ich mich nicht gerührt hatte, war wohl der schmerzhafte Einstich auch bei ihm bemerkbar: er wandte sich um mit einem kleinen Lächeln, ehe ich meinen Blick hatte zurücknehmen können. Professor Malon stockte ein wenig in seiner Rede, wie erschrocken, aber er brauchte nicht besorgt zu sein, ich lächelte natürlich nicht. Es war nur plötzlich wie ein helles Geflimmer über dem Saal, ich sah nichts mehr deutlich, konnte den Blick auf nichts Bestimmtes mehr richten, als wären die Augen von diesem sekundenlangen Anblick übermüde geworden.
Ohne Bedauern sah ich Felix Erlach gehen nach der Vorlesung.
Ich wusste ohnehin, dass er die folgende von Wiggert nicht mit anhörte. Wohin er ging, fragte ich mich nicht. Was er jetzt tun, mit wem er zu Mittag essen würde, war nicht wichtig, wichtig war dieses kleine vertraute Lächeln. Ich hob es auf, bettete es in mich ein, und manchmal machte es mich selber lächeln.
Es war fast Mittag, als der Hörsaal uns entließ aus seiner Kühle. Ich schlenderte über die Höfe dem Kreuzherrenplatz zu, halb und halb entschlossen, heute nun endlich hinüberzudringen über die Karlsbrücke ins älteste, wirkliche Prag, und drüben nach Lindes Domizil zu forschen, obwohl sie es mir nur ungenau beschrieben hatte. Es musste ein hübsches altes Haus sein, am Kleinseitner Ring, gegenüber der Straßenbahnhaltestelle, so hatte sie gesagt. Sie wohnte dort bei Ankas Eltern zur Untermiete.
Zwar machte mich der Gedanke ängstlich, mich in dieses Haus einzudrängen, aber ich wusste doch nicht, ob es nicht richtig und nötig war, dass ich mich nach Linde umsah, da ich einmal ihren Kummer kannte. Zwar traute ich mir nicht zu, viel trösten zu können, aber Anka, meinte ich bei mir, mochte zu einem solchen Amt noch weniger taugen, wenn sie überhaupt von allem wusste. Und Hartmuth wieder würde in dieses Haus wohl nicht mehr gerne gehen.
Warm und still stand die Luft über dem Platz, als ich hinaustrat durch die kleine ausgesparte Tür in dem Tor von Schmiedeeisen. Das Wasser des Moldauwehrs brauste nahe hinter den Häusern. Summend wie ein Orgelton stand dieses Brausen über der Weite des Platzes, die doch eng schien, da sie bestürmt war von drei gewaltigen Bauwerken: zur Linken von den figurengekrönten drei Toren der Salvator-Kirche, zur Rechten von der Kuppel der Kreuzherrenkirche, die weiß leuchtete in ihrer Höhe vor dem mildblauen Himmel, und vom Altstädter Brückenturm da schräg gegenüber, dem ältesten der drei, der wahrhaft väterlich dastand, der breite Turm bewehrt mit kleineren Türmchen, und unter den Steinbildern der Könige das Spitzbogentor offenhielt, den Eingang in die Welt jenseits der Moldau.
Das Tor, aus dem ich trat, war in diese Fülle nur bescheiden eingezwängt, ein Zaungast nur. Während ich den Platz überschritt, tat sich mir auch der Blick nach drüben auf, über den Fluss hin, und es war, als träten aus der Ferne her auch Burg und Dom und die Kuppeln und Türme und Dächer der Kleinseite noch herein in diese dichte Fülle, in deren Mitte Kaiser Karl auf steinernem Sockel residierte.
Nahe dem Kaiser, auf einer Bank am Wasser, saß eine alte Bäuerin im schwarzen steifen Rock, das schwarze Kopftuch unterm Kinn zugebunden, in der warmen Sonne. Sie bestaunte nichts von dem, was um sie war. Seit ihrer Kindheit mochte sie’s gesehen haben, wieder und wieder, wenn sie ihre Sachen zum Markt brachte und in der Mittagssonne hier ein kleines Nickerchen tat.
Frieden war um sie her, wie sie da saß, und doch dachte ich, wie das sein müsste, wenn man nichts von allem hier wirklich sah. Und wie ein besonderes Glück fühlte ich es plötzlich, dass ich nicht hier geboren war, dass ich all diese Bilder nicht gewohnt war von Kindheit an, sondern dass ich sie sehen konnte mit dem Entzücken, das nur das Neue und noch nie Gesehene so stark in uns weckt.
Durch den steinernen Torbogen des Turmes ging ich — kühl wehte es mich an von der Mauer her — und wechselte hinüber auf die linke Brückenseite, da ich sah, dass auch die andern wie nach einem ungeschriebenen Gesetz sich links hielten auf dem Wege hinüber. Schließlich waren in diesem Land bis vor Kurzem auch die Kraftfahrzeuge auf der linken Straßenseite gefahren. Grün wuchs es vom Ufergrund herauf zu der Brücke und ihren steinernen Gestalten, die hoch von ihren Sockeln sich herneigten zu dem, der vorüberging. Da standen sie, Bilder einer Zeit, in der das Himmlische sich noch besprach mit dem Irdischen; Sonnenlicht zeichnete den Faltenwurf ihrer Kleider nach, dass es fast schien, als bewege sie der Wind. Da neigten sie sich her, als hätte man sie etwas gefragt, als müssten sie Rede und Antwort stehen. Aber wer fragte sie noch? Die hier gingen, gingen vorbei, kaum, dass einer zu ihnen aufsah wie ich. Und doch waren sie nicht tot, schienen aus irgendeiner Ferne her Leben zu empfangen und auszuteilen.
Ich blieb stehen, um in meiner Kollegtasche nach der Sonnenbrille zu suchen, gespannt, ob sich das Bild durch den schmeichlerischen dunklen Ton des Glases noch schöner ausnehmen könnte. Da fiel mein Blick auf einen kleinen weißen Gegenstand vor meinen Füßen. Ich bückte mich danach und hob ihn auf. Es war ein Würfel, nicht größer als ein Kirschkern, und die Zahl, die mir entgegensah, war eine Sechs. Sah es nicht aus, als wollte die Stadt mich damit locken und für sich gewinnen?
Ich dachte an das, was Hartmuth am Tag vorher über die Stadt gesagt hatte: „Als ob man sie nur lieben dürfte, als ob sie alle andere Liebe mit Eifersucht verfolgte…” Ich hielt den Würfel auf der flachen Hand vor mich hin. Die sechs Augen blickten mich an. Ein Mann, der vorüberging, spähte neugierig nach meinem Fund. Es handelte sich ja nicht um einen Wertgegenstand, zu geringfügig, deswegen irgendwelche Umstände zu machen, gar den Verlierer zu suchen. Und doch lag in der Sechs, die mich ansah, eine geheime, lockende Bedeutung; sie erfüllten mich mit Zuversicht und Vorfreude. Ein Versprechen war es, eine sichere Hoffnung.
Die Kleinseite empfing mich, wie die Altstadt mich entlassen hatte: mit grünenden Zweigen, die heraufwuchsen zu den Figuren der Heiligen und mit einem Spitzbogentor, das diesmal allerdings flankiert war von zwei Türmen, die wie Mutter und Tochter hier der Muße pflegten, beide etwas zur Fülle neigend, während der Vater hochgewachsen und kräftig drüben am andern Ufer Wache hielt. Zwischen die beiden behäbigen Türme aber, Mutter und Tochter, drängte sich hoch und gewaltig das Bild einer Kirche, Turm und Kuppel.
Wieder empfand ich den Durchgang durch das kühlende Tor als Wohltat, mir war ganz wirr im Kopf von Sonne und Bildern. Alle Lust, einen Besuch zu machen, war mir vergangen. Im Schatten der Gasse strebte ich den noch kühleren Laubengängen zu, immer das Bild der Kirche vor Augen, die über die winzigen Menschen, Schubkarren und Autos hochragte wie in den Himmel hinein.
Als sich unter den kühlenden Bogen der Kolonnade neben mir eine Tür in ein Restaurant öffnete, trat ich ein, ohne zu zögern. Es war eine ältliche behagliche Gastwirtschaft. Licht brannte hier, wohltuend milde nach der grellen Sonne. Als ich die Sonnenbrille abnahm und in die Tasche steckte, sah ich in einer der Nischen Anka sitzen und neben ihr einen Mann in Soldatenuniform. — Soldat oder Offizier — ich konnte das nie erkennen, besonders wenn einer keine Mütze trug. Ich entschied es dann von Fall zu Fall nach dem Gesicht, aber damit hatte ich oft wenig Glück.
Ich war etwas ratlos, wollte mich fortwenden, was allerdings schwierig war in einem so engen Raum, aber Anka rief mich schon an den Tisch und zog mich an der Hand auf einen Stuhl ohne große Formalitäten der Begrüßung oder Vorstellung. Sie wählten grade, ich tat es ihnen nach. Erst dann deutete sie auf ihren Begleiter, einen unscheinbaren kleinen Mann, jung noch, jünger wahrscheinlich, als man ihn schätzte, denn er hatte einen Zug in seinem Gesicht, das nicht jung sein konnte, nicht jung sein wollte vielleicht. Seine Augen waren schön, grau und wolkig und vielfältig in dem unbedeutenden Gesicht.
„Das ist Schönow”, sagte Anka. „Voriges Jahr hat er hier studiert, diesmal gibt er nur ein Gastspiel. Der Herr General aus Frankreich!” Und sie schnippte das Ende seines Schulterstücks hoch. Obwohl ich mir auf die Zeichen darauf keinen Reim machen konnte, sagte ich mit Staunen, aber doch ohne große Begeisterung:
„Sie sind mein erster General!” Anka lachte.
„Der Herr General! Der Herr Uhrengeneral! Uhrenwurm habe ich ihn immer genannt, aber jetzt werd’ ich ihn Uhrengeneral nennen, das klingt doch viel mehr nach was. Er sammelt nämlich Uhren, weißt du. Am liebsten würd’ er auch die vom Altstädter Rathaus sammeln, wenn sie nicht so groß wär’!”
„Du stellst es immer dar, als stehle ich mir meine Uhren zusammen — stehle? Stehlte? Stöhle? Stähle? Gibt es da keinen Konjunktiv?”
Nein, wir beschlossen, es gab da keinen, keinen annehmbareren als den Indikativ, der Schönows genaues Gemüt nicht zufriedenstellen konnte. Wunderlicherweise fand ich nichts dabei, dass Anka ihn nur „Schönow” genannt hatte, ohne „Herr”, ich nannte ihn auch bei mir selber so und vermied es, ihn mit seinem Namen anzureden. Es war, als müsste das „Herr” ihn herabwürdigen, ihn einordnen in eine unübersehbare Reihe von „Herren”, mit denen er nichts gemein hatte.
Das Gespräch floss so weiter, es drehte sich nämlich um eine Uhr, die Schönow eben beschreiben wollte, als ich eintrat.
„Rundherum war es wie kleine Rosenblätter geflochten, so dass die ganze Uhr wie eine Blume aussah. Geflochten war es aus Haaren, die fast genau so golden waren wie das Gold der Uhr, ein helles Rötlichblond. Auf der Rückseite war eine Widmung eingraviert: „Cela vous protegera. C.S.” Cela vous protegera — weißt du, woher das kommt?”
Anka breitete die Hände flach vor sich hin wie Fächer und schüttelte den Kopf. Nein, sie wusste es nicht.
„Ich wäre vielleicht auch nicht drauf gekommen”, fuhr Schönow eifrig fort, „wenn ich nicht in der Bibliothek das Buch gefunden hätte. Ein deutsches Buch. Ein Buch vom Krieg.”
Aufmerksam uns beide der Reihe nach ansehend, wollte er uns einhelfen, wie man Kindern einhilft, wenn sie ein Gedicht nicht weiterwissen. Anka hatte die Hände vorm Gesicht flach zusammengelegt, die Daumen unterm Kinn, und die Nase, das einzig Ungemässe ihres Gesichts, barg sich in der flachen Höhle zwischen den Handflächen.
„Cela vous protegera — ein Buch vom Krieg? Der Cornet?”
Schönow schlug sich auf die Schenkel, was eine drollige Wirkung machte bei seiner mageren Figur.
„Der Cornet — in der Bibliothek eines französischen Schlosses! Was sagst du dazu?”
Anka hatte offenbar keine Lust, viel dazu zu sagen. „Phantastisch!” murmelte sie — das gaumige, fast nasale n, das offene zweite a — ich hatte es schon einmal von ihr sagen hören, aber heute war kein Nachdruck dahinter.
„Geh, du bist fad heute”, sagte Schönow, „aber warte nur, du wirst es lesen und du wirst sehen -”
„Du hast es denn mit?” fragte Anka mit erwachtem Interesse.
„Ich habe es nicht gestohlen, wie du wieder annehmen wirst”, erwiderte Schönow. „Ich hab es abgeschrieben mit diesen meinen Fingern -” und er streckte sie gespreizt in die Höhe, alle zehn, es waren schmale schöne Finger. „Abgeschrieben habe ich es, eh’ ich herkam, und du wirst es zu lesen kriegen, sobald wir draußen auf dem Wasser sind. Hierher”, und er fuhr mit der flachen Hand über den blankgescheuerten groben Tisch — „hierher passt es nicht.”
„So — werden wir denn draußen auf dem Wasser sein?” erkundigte sich Anka erstaunt.
„Sobald dieses Mahl hier vollzogen ist.” Anka schien mir heute abwesend, fast ein wenig ungehalten. Das Heft war ihr aus der Hand genommen.
„Übrigens, was die Uhr betrifft”, fuhr Schönow fort in dem offensichtlichen Wunsch, genau zu sein, „nachher hat es mir leid getan, dass ich dieses eine Mal nicht doch meinem Grundsatz untreu geworden bin, dass ich sie nicht mitgenommen hab. Man hätt’ sie ja später zurückgeben können, der Eigentümer des Schlosses müsst’ sich ja ermitteln lassen. Dann wär’ sie wenigstens noch ganz.”
„Ich denke, bei dir gehen alle Uhren kaputt?” erkundigte sich Anka. Schönow schüttelte den Kopf über ihr störrisches Wesen.
„Du verwechselst das. Sie gehen nicht kaputt, sie gehen nach. Aber bei dieser Uhr war es ja nicht so wichtig, dass sie ging, sie brauchte nur da zu sein, das wäre schon genug gewesen.”
„Und wieso ist sie nicht mehr da?”
Schönow hob das Bier zum Mund, das die Kellnerin vor ihn hingestellt hatte. Er trank, versäumte es aber danach, sich den Schaum von den Lippen zu wischen, so dass ihm rechts und links zur Nase eine weiße Schnurrbartspitze hochstrebte.
„Dieser Flügel des Schlosses wurde zerstört”, sagte Schönow. „Eine sinnlose Sprengung: dahinter waren Befestigungsanlagen, aber das Schloss hätte man auf jeden Fall schonen können. Die Bewohner waren geflüchtet, es muss noch alles so gelegen haben, wie ich es gesehen hatte, wenn nicht schließlich doch einer die Uhr mitgenommen hat.”
Anka spielte mit den Bierdeckeln, also sah er mich an, und ich strich mir rasch mit den Fingern über der Lippe entlang; er verstand es dankbar und zog sein Taschentuch, sich den Mund zu wischen, noch ehe das Komische seines Anblicks mit dem Tragischen seiner Erzählung in Konflikt geraten konnte.
Einen Augenblick lang war der Krieg gegenwärtig in diesem Raum, der dem Kriege so fern lag. Drei Jahre dauerte er schon, drei Jahre lang verloren Menschen ihr Heim, waren auf der Flucht, wurden getötet. Aber das alles war so fern, es war eher wie eine Geschichte oder wie Historie. Selbst Schönow, der dabei gewesen war, konnte die Wirklichkeit des Krieges nicht mit sich bis hierher bringen. Sie musste ihm unterwegs verlorengegangen sein. Geblieben war die Geschichte von einer Uhr, die er gesehen und bewundert hatte. Nur im Nebensatz kam es heraus, wie Schlösser zerstört und Menschen verjagt wurden.
Nach dem Essen, draußen unter der Wölbung des Laubenganges, wollte ich mich verabschieden. Ich hätte nach Linde sehen wollen, sagte ich. Es wäre mir am Tage vorher vorgekommen, als ginge es ihr nicht so gut.
„Die Linde? Die ist gesund wie ein Fisch im Wasser. Ausschaun tut sie immer, als müsst’ sie gleich umfallen, aber sie ist zäh wie Leder, da brauchst dir keine Gedanken zu machen. Außerdem ist sie gar nicht daheim. Die hat zu tun bis an den Hals, der Wiggert will auf einmal sein Buch fertigmachen.”
„Aber das -” ich verstummte. Das ist doch nicht möglich, hatte ich sagen wollen, aber was ging es mich an, und was für ein Recht hatte ich, Sachen auszuplaudern, die Anka — vielleicht — noch nicht wusste, die ich auch nicht gewusst hätte, hätte sie mir nicht der Zufall vor Augen geführt.
„Da schau, sie will sich bloß vorm Rudern drücken, die Fränzi”, sagte Anka jetzt. „Geh, tu was für einen müden Krieger, und mich lasst’s auch mitfahren, ich mag mich nicht anstrengen heut. Es ist eh’ so heiß.”
Es traf sich gut, dass das Rudern eine Liebhaberei von mir war, eine unglückliche allerdings, denn ich musste immer erst überlegen, mit welchem Schlage das Boot zu lenken war, von allein wusste ich’s nie. Aber diese bescheidenen, beschränkten Fähigkeiten, sagte ich, wollte ich gerne in den Dienst der Allgemeinheit stellen und wurde also dankbar ins Schlepptau genommen.
Fort ging’s vom Kleinseitner Ring, durch eine schmale krumme Gasse wieder auf eine Kirche zu, die sich breit, behäbig und festgefügt uns in den Weg stellte und das Gässchen zum Ausweichen zwang. Wie wunderlich war hier alles verstellt und verschoben in reizender Unordnung! Nichts war mit dem Lineal gezogen, alles mit der Hand gezeichnet, langsam, liebevoll, auf Abwechslung bedacht war es gezeichnet, ein bisschen unsicher, ob das Ganze auch Wirkung machen würde. Da war nichts von der phantasielosen Zuversicht der modernen Städteplaner, die entschlossen ihre Linien ziehen hin und her und alles zerstören, was heimlich und besonders werden könnte.
Schon nach der ersten Biegung der Gasse verscholl hinter uns der Lärm der großen Straße, das Klingeln, Hupen und Hasten. In ländlichem Frieden, in warmer Sonne lag da der Platz, über den wir gingen. Eine weiße Katze strich träge an der Hauswand hin und verschwand in einem Tordurchgang, auf den Anka eben deutete: „Da hat der Beethoven gewohnt, und da -” sie zeigte in anderer Richtung, „heben sie heute noch das Manuskript vom Kopernikus auf über die Bewegung der Himmelskörper, mit dem er sich beinah um Kopf und Kragen geredet hätte.”
Und dort neigten sich schon wieder Figuren von ihrem steinernen Sockel — wie sie alle lebendig waren, lebendiger als die, die zu ihren Füßen hin und her gingen, zu hastig, um eine Spur zu hinterlassen.
„Und hier”, Anka deutete mit dem Kopf nach links, „ins Grandprioratspalais soll der Hartmuth ziehen mit seinem Institut. Dem stehen schon die Haar’ zu Berge, ich denk mir immer, er zündet’s noch mal an, bloß dass er nicht umziehn muss.”
Ich sah hinauf zu Portal und Fenstern, dann bogen wir um die Ecke, und noch stiller wurde es, eine weltabgeschiedene Stille, in die nur die Vögel auf den Bäumen leise hineinschwatzten.
Schon warfen die Linden helle durchsichtige Schatten auf das holprige Pflaster. Unbeschnitten neigten sich ihre Zweige, zum Greifen tief. Gras wucherte dicht zwischen den Steinen. Ein Duft war in der Luft wie Erinnerung und Vergessen zugleich, alte, alte Zeit, so lange vergangen und doch gegenwärtig im Schwunge der Fenstersimse und Portale, in den verspielten Schnörkeln einer Gartenmauer, in der Stille, im stummen, fast versiegten Fließen des schmalen Wasserarms, über den wir jetzt hingingen, im Efeu, dem Gewächs der Toten, das über die Ufermauer hinunterwucherte, in dem alten Mühlrad, das müde geworden und endlich stehengeblieben war. Alte Zeit, Gewebe von Erinnerung und Vergessenheit, zu leicht für Menschenhände und zu zart fast, um die zögernden Laute der Vögel zu ertragen.
An ärmlichen, halbverfallenen Häuschen vorbei kamen wir jetzt zum Wasser. Da sah ich etwas, was mich zugleich freudig erstaunte und wunderte: im blauen Kleide mit weißen Punkten, da saß sie, wie sie am Morgen aus unserem Zimmer fortgegangen war, Maria, den Zeichenblock auf den Knien, am Wasser und malte, viel zu vertieft, um uns zu bemerken. Mir war, als wäre ich inzwischen aus einer Welt in eine andere und wieder in eine andere hinübergewechselt. Einen Augenblick lang konnte ich es nicht begreifen, dass sie, die ich zurückgelassen hatte in der ersten Welt, jetzt auch hier war.
Unmöglich konnte ich vorbeigehen und mich blind stellen. Aber ich fragte mich auch, wie man diese beiden Welten zusammenbringen könnte. Ich ging über das holprige Gestein, das sich flach dem Wasser zuneigte, bis dicht zu ihr hin und sagte:
„Hallo, Maria!” Sie sah sich um, nicht erschrocken, aber auch nicht grade entzückt über die Störung, sah zu mir auf: „Hallo, Franziska!” und dann weiter zu den Beiden, mit denen ich gekommen war. Jetzt erst lächelte sie, es war das förmliche Lächeln des ersten Morgens, das sie inzwischen längst abgelegt hatte. Sie legte den Zeichenblock auf die Steine und stand auf:
„Graf Schönow, lassen Sie sich auch mal hier sehen, nachdem Sie andern Leuten dauernd versichert haben, man könnte nirgendwo leben als in Prag?”
Der war herangekommen und beugte sich über ihre Hand: „Frau Baronin, Sie hätte ich allerdings zuletzt hier vermutet!” (Ich fragte mich, ob er wohl jemals Anka so andeutungsweise die Hand geküsst hatte.)
Über Marias Nasenwurzel stand einen Augenblick lang eine kleine steile Falte, so, wie wenn jemand sich in einen Schuh zwängen muss, den er schon abgelegt hatte, weil er zu eng war.
„Jedenfalls bin ich Ihnen dankbar, dass Sie mich verführt haben, herzukommen an den Busen der Alma Mater Pragensis, wie man das so hübsch sagt. Sie haben recht, Prag muss man gesehen haben, ehe man stirbt.”
„Ich hoffe doch, Sie sind nicht hergekommen, weil sie schon ans Sterben denken, Frau Baronin.” Ich fand, er betonte das „Frau Baronin”, als wollte es ihr einer streitig machen. Ich fühlte mich auf einmal merkwürdig bürgerlich, wurde sozusagen erst meiner Bürgerinnen und Bürgerlichkeit gewahr neben so adliger Gesellschaft. Aber zugleich wusste ich: es wog nichts, jedenfalls nicht viel. Was wog, waren die drei Menschen, die da neben mir standen, und sie wogen, jeder seinem Schicksal, seinem Tun und seinem Wesen gemäß, abgelöst von ihren Namen.
„Ich glaube”, erwiderte Maria, „ich bin aus demselben Grunde hergekommen wie Sie. Wir sprachen einmal davon beim Reiten am Müggelsee — erinnern Sie sich? Sie sagten, hier ist man frei von den Formen — man ist es ja mehr oder weniger überall, wo man nicht zu Hause ist, wo man die Formen nicht mit sich herumschleppt von Haus zu Haus. Aber es ist wahr, man ist es hier besonders.”
„Der Beweis steht hier vor Ihnen”, erwiderte Schönow, „Anka Gräfin zu Waldenfurth, geboren in Prag, wohnhaft in Prag, aber frei wie ein Vogel. Und das ist Baronin Scharff-Habeland, beide unbekannterweise bekannt miteinander durch meine Wenigkeit.”
Jede schien an der Anderen Gefallen zu finden, ein seltener Fall, dachte ich, nur möglich bei einem Mittelsmann wie dem Uhrengeneral. Zwar war es schwer, sich Anka von irgendeinem Menschen besonders beeindruckt vorzustellen, und Maria war einmal gewiss nicht dieser Mensch. Sie sah reizend aus, wie sie so vor uns stand, leicht und hell und flüchtig in ihrem Sommerkleid, glücklicherweise wie seit Tagen schon ohne Blume, ohne Band, ohne die hellen gehäkelten Zwirnshandschuhe, die sie manchmal plötzlich trug, ohne zu fragen, ob sie ihrem Anzug zuträglich waren oder auch nur zu ihm passten. Wieder belebte die Nähe des Flusses die Farbe ihrer Haut, machte sie lebendiger und sicherer, wie die Nähe hilfreicher Geister. Aber sie blieb immer noch blass und wie durchsichtig.
Ja, sie stand da wie der Gegenpol zu Anka, die so leibhaftig war, so gegenwärtig, so scharf gezeichnet gegen den Hintergrund der überschatteten Mauer. Ich sah es, wie Maria sofort angezogen war von dem so sehr Lebendigen in diesem Gesicht. Ich sah auch, wie sie sofort das Anspruchsvolle des Gesichts vermerkte, aber nicht übel vermerkte, sondern als so natürlich, wie wir alle es nahmen.
„Ich freue mich sehr, Sie einmal zu sehen”, sagte Maria und gab Anka die Hand. „Ich habe so viel von Ihnen erzählen hören.”
„Ich frage mich manchmal, wie meine Freunde in der Ferne über mich reden”, sagte Anka, „da sie offenbar so viel über mich reden. Es kann ja nicht immer nur Gutes sein.”
„Doch, das war’s in diesem Falle. Der Graf -” sie winkte mit dem Kopfe zu ihm hin, „sieht ja gerne nur das Gute.”
„Wir wollen in See stechen, Baronin”, sagte Schönow jetzt. „Wollen Sie nicht mittun?” Maria zögerte.
„Da wir ja hier frei sind wie die Vögel”, antwortete sie schließlich, „und da die Form hier keine Rolle spielt, möchte ich lieber bleiben und fertigmalen. Wenn ich Zeit habe, werde ich Ihnen winken, und wenn Sie Schiffbruch leiden sollten hier in der Gegend, werde ich Hilfe holen. Das genügt im Augenblick meinen Bedürfnissen nach Gesellschaft.”
Mit einem Winken verabschiedete sich Schönow — offenbar wollte er eine Wiederholung des Handkusses vermeiden, den er vorhin, alter Gewohnheit folgend, praktiziert hatte und der anscheinend auch unter die unerwünschten und verabschiedeten „Formen” zu rechnen war. Er und Anka gingen weiter.
Maria berührte mich am Arm und legte den Finger auf die Lippen. Ich bewegte bejahend die Augenlider: ja, ich hatte verstanden. Die Formen verabscheute sie, aber auch zur Wahrheit wollte sie sich nicht bekennen, so wie sie Titel und Namen nicht abgelehnt hatte, die sie doch nicht mehr führen wollte. In einem unwirklichen Zwischenreich wollte sie bleiben, hier die sein, und dort eine andere. Aber so frei, dachte ich, so frei ist kein Mensch. So konnte man Freiheit nicht missbrauchen.
„Wir werden ein Pfand lassen müssen”, sagte Anka eben, als ich zu den beiden stieß. „Gib halt deine Uhr, aber richt’ sie erst, sonst wird der Charon misstrauisch.” Heimlich und eilig richtete Schönow seine Uhr nach dem Altstädter Wasserturm drüben am Ufer, dann traten wir in Verhandlungen um ein Boot ein und bestiegen bald darauf das lange schmale Gefährt.
Schönow schlug vor, wir sollten losen um den Posten des Rudergängers.
„Wir können würfeln”, sagte ich und zog meinen Würfel hervor. „Ich hab ihn grad gefunden oben auf der Karlsbrücke. Die Sechs lag nach oben.” Das gefiel Anka. Sie nahm ihn auf und ließ ihn auf die Bank rollen.
„Ist er nicht herzig?” Die Sechs lag nach oben. „Es ist ein Sechsenwürfel”, meinte sie. Aber das war er nicht; Schönow warf eine Vier und ich eine Eins, so dass der Zufall genau entschieden hatte über die Rangordnung.
Wie üblich machte es mir Mühe, aus dem Bootshafen hinauszustoßen ins freie Wasser, und mit etwas Bangen sah ich die breiten hölzernen Eisbrecher an der Brücke und die Brückenbogen, so dass ich vorschlug, wir sollten uns moldauaufwärts halten, aber Anka bestand darauf, die Certovka zu befahren, man fühle sich da wie in Venedig.
„Was brauchst du in Prag dich wie in Venedig zu fühlen?” fragte Schönow, der meine Bedrängnis sah. Aber sie wischte das weg mit großer Geste gegen das Wasser hinaus, das von hier riesig schien, viel gewaltiger noch als vom Ufer her. Die Stadt, die so lebendig sich auf und ab hob und senkte, wenn man durch sie hinging — jetzt sah sie flach aus, war hingesunken bis auf einen schmalen bedeutungslosen Rand, der ferne das Wasser umgrenzte. Es war merkwürdig, wie hier vor einem sich alles Andere zurückzog, wie jedes so voll zu seinem Recht kommen und seinen Platz ganz für sich beanspruchen durfte, während alles andere bescheiden zur Seite trat, wie es dann Kulisse blieb und Rahmen.
Ängstlich steuerte ich einer der Durchfahrten zu, brachte das Boot in die richtige Richtung und zog dann die Ruder ein, um es treiben zu lassen. Aber ich hatte nicht bedacht, dass ich auf der linken Seite geblieben war. Drei Schleppkähne zogen moldauaufwärts in derselben Fahrtrinne. Langsam, aber gewichtig hielten sie auf uns zu, und während der steinerne Bogen über uns vorbeiglitt, machte ich eilig meine Berechnungen, welches der Ruder ich in welcher Richtung bewegen müsse, um uns in Sicherheit zu bringen.
Glücklicherweise trafen meine Berechnungen zu, der Nachen trieb nach links hinüber, obwohl ich üblicherweise nach rechts hätte ausweichen müssen, aber der Umweg um die Reihe der Schleppkähne schien mir doch zu gewaltig, da ja die Einfahrt in die Certovka so nahe war.
Als sie nahe herangekommen waren, sahen wir, dass eine Frau am Steuer stand. Ein halbwüchsiger hochaufgeschossener Bursche hockte neben ihr auf dem Geländer und sah neugierig zu uns herüber. Wir sahen, wie er seine Mutter anstieß, sie solle auch zu uns sehen, und da sagte Anka auch schon:
„Ach, die Frau vom Frantisek, da schau her. Liebe Güte, da fährt sie jetzt allein mit ihrem Kahn. Bloß den Jara hat sie noch zum Helfen. Den Mann haben sie ihr erschossen im vorigen Herbst, ein Baby hat sie am Schürzenbandel, das war noch nicht geboren, da war der Vater schon tot.”
Sie winkte hinüber, die Frau hatte indessen dem Burschen das Ruder übergeben, kam zur Reling und rief etwas auf tschechisch herüber. Anka antwortete. Die fremde Sprache in dem bekannten Munde mutete mich sonderbar an. Es ging so eine Weile hin und her; die Frau lief den Schleppkahn entlang, um neben uns zu bleiben. Es lag ihr offenbar viel dran, noch etwas zu sagen. Dann blieb sie zurück. Die Kähne tauchten in den Schatten des Brückenbogens und zogen gelassen weiter stromauf.
Auch wir trieben weiter, ich rührte manchmal leise mit dem Ruder im Wasser, um die Richtung zu halten, ganz beschäftigt damit, wie Anka zu dieser ärmlichen Frau gesprochen hatte. Das Anspruchsvolle war nämlich plötzlich wie fortgewischt aus ihrem Gesicht; war es, dass sie hier ihren Anspruch nicht stellte, oder dass er hier erfüllt war. Ihr Gesicht war plötzlich wie gesprungen, ja, es schien mir, als hätte sie vielleicht geweint, wären wir nicht dagewesen.
„Die arme Haut”, sagte sie endlich, und ihre Stimme war rauh, „jetzt hat sie bloß noch den Jara, und der ist so lang und so breit, dass ihm die Sachen nicht passen von ihrem seligen Mann, wie sie immer sagt. Jetzt will sie die Sachen tauschen; es ist so rührend, man muss sie ja nehmen, wenn einem auch keiner was gibt für das abgetragene Zeug. Aber das kann man ihr ja nicht sagen, zu Tode gekränkt wär sie, geschenkt will sie nichts. Ich denk’, wir haben schon was zu Hause vom Christoph, der zieht’s eh’ nicht mehr an. Aber geschenkt will sie’s nicht, sie will ihres dafür geben.”
Die Certovka war jetzt da; ich rührte das Ruder mehr, um den langen schmalen Kahn um die Ecke zu lenken hinein in die enge Gasse von Wasser zwischen den weißen Häusern. Aus schmalen Stücken Hof wuchs auch hier Efeu auf und nieder an den Mauern, hing über Türen, die sich zutraulich zum Wasser wandten wie auf die Straße, rankte sich um die Fenster, die der Sonne offenstanden.
Anka hatte sich vorgeneigt und ließ ihre Hand durchs Wasser gleiten. „Das Leiden tötet oder wird getötet selbst durch den Leidenden. — Dann ist’s getan! Das ist Venedig, das ist Prag, das ist überall in der Welt.”
„Der Mann — ist er im Krieg gefallen?” fragte ich.
„Oh nein, gefallen ist er nicht. Der Herr Reichsprotektor, als er voriges Jahr anfing, dieses Land zu ‚beschützen’ ” — sie sagte es scharf und kalt, „hat zur Begrüßung ein paar hundert Mann erschießen lassen. Mein Onkel hat’s in den Akten gelesen oben auf der Burg. Es waren über vierhundert. Einer von ihnen war der Frantisek. Mich hat er einmal aus dem Wasser gezogen, als ich noch ein kleines Ding war. Deswegen hat sie mich auch nur gebeten. Sie weiß, dass ich das nicht vergeß. Und dann ist er selber gestorben von einer deutschen Kugel, weil er verdächtig war.”
Sie fuhr sich durch das Haar, das in der Sonne glänzte. „Ach was, reden wir nicht davon. Wir können ihn nicht mehr lebendig machen. Erzähl was Lustiges, Uhrengeneral!” — „Uhrengeneral — was für ein Wort!” Sie warf den Kopf zurück in einem plötzlichen Umschwung der Stimmung. Zögernd, aber unaufhaltsam hob sich der Schatten, der sich gesenkt hatte auf den hellen Tag. Es wurde wieder Licht zwischen den weißen Mauern, die die Wärme der Sonne festhielten und ausstrahlten. Alles schien ihr zu gehorchen, sie konnte es dunkel und hell werden lassen.
Bis zur Karlsbrücke schifften wir, dann wieder rückwärts durch das enge Gewässer, und ich war froh, als wir wieder im Strom draußen waren; die Bogen der Karlsbrücke kamen mir jetzt breit vor. Ich passierte sie rudernd gegen den Strom. Da saß Maria im blauen Kleid mit weißen Tupfen.
„Wir leben noch”, winkte Anka hinüber, wie seit Jahren mit ihr bekannt — ja, was denn? Mich sah sie ja auch erst zum zweiten Mal, und doch fuhr ich hier mit ihr im Kahn, als gehöre es sich so und sei immer so gewesen.
„Ein Stückel noch aufwärts bis zur Schützeninsel”, sagte sie bittend und dehnte sich nach rückwärts, fast übers Wasser. „Eine Pracht ist das, so faul sein und gefahren werden. Am Laurenziberg blüht’s jetzt bald — hast’s schon gesehen, Uhrengeneral? Wir müssen mal rauf, am Abend, wenn die Lichter an sind.”
Ich lenkte den Kahn nach links in die Mitte des Stromes. Ja, richtig, dort oben blühte es, fing an, zu blühen. Noch war hinter dem weißen Schleier das Grün des Rasens sichtbar, das Schwarz von Zweigen und Stämmen, das Grau der Wege. Aber bald würde man sicher nichts mehr sehen, bald würde der ganze Berghang ein weißes Meer sein. Seltsam, dass ich es über all dem andern noch nicht hatte dort oben blühen sehn!
Wir blieben noch lange auf dem Wasser. Möwen glitten manchmal zu uns her, weißglänzende Bettler, glitten vorbei, da sie enttäuscht wurden und strichen an den Zweigen der Trauerweiden entlang wieder hoch hinauf ins Blau, schwebten über die Brücke und kehrten endlich in weitem Bogen zu ihren Plätzen zurück, drüben auf den Holzböcken des Wehrs. Hier auf dem Wasser war es still, die Stadt war rund um uns und doch fern, nur die Bäume am Ufer standen nahe und redeten vom Frühling.
Wir lasen den Cornet: „Le chant de l’amour et de la mort du Cornet Christoph Rilke” — Anka laß es mit tönender Stimme, weit ausholend zu den Vokalen, manche der Konsonanten mit besonderem Nachdruck hervorstoßend; sie las es sehr französisch, aber eben doch nicht völlig französisch, da sie es war, die es las. Sie wiederholte diesen wunderlichen Zwieklang „de l’amour et de la mort”, und die beiden Worte, ganz verschiedenen Stammes, wurden in ihrem Munde miteinander verwandt.
Auch andere Worte, lange bekannt, gaben sich erst jetzt in der fremden Sprache wirklich zu erkennen. Ihre Schönheit wurde deutlicher — wunderlicherweise — als sie ausgetauscht waren gegen die Worte der fremden Sprache. Nie hatten wir gedacht, dass diese Sprache übersetzbar wäre, aber sie war es, war noch vorhanden in der fremden Sprache, noch mehr vorhanden beinahe, obwohl das merkwürdig klingt.
Manchmal legten wir an irgendwo am Kai; wir kamen auch zu dem Schleppzug der Frantiseks, die ausluden und auf neue Ladung warteten. Anka machte einen kurzen Besuch drüben, dann kehrten wir um. Drei Stunden waren wir unterwegs gewesen; der Uhrengeneral hatte eine gewaltige Zeche zu bezahlen. Er nahm seine Uhr im Empfang und stellte sie gelassen wieder zurück.
Maria war gegangen. An einem tiefhängenden Zweig schaukelte ein Zeichenblatt im Winde. „Liebe Seeleute, auf Wiedersehn. Ich muss in die Vorlesung. Maria.”
Es lag mir doch daran, Linde zu sehen, zu wissen, dass sie unversehrt war. Ich sah sie auch. Sie hockte auf einem altväterlichen, mit rotem Plüsch bezogenen Sessel am Fenster ihrer Mansardenstube, in die wir alle drei eindrangen — ich wäre lieber allein gegangen, aber was ließ sich sagen gegen Anka, noch dazu in ihrem Haus?
Etwas erschrocken sah Linde uns kommen, ausgewärmt und müde von Sonne und Wind und so viel mehr am Leben als sie. Als ich sie da hocken sah, musste ich an Menschen denken, die — mit verletztem Rückgrat — nur weiterleben können, weil ein metallenes Gestänge sie aufrechthält. Dieses Gefühl behielt ich lange Zeit, wenn ich Linde sah. Sie hielt sich aufrecht, sie täuschte Leben vor, aber es war nur ein künstlich aufrechterhaltenes Leben, eine einzige Mühsal, bis sie sich fallen ließ.
Sie versuchte es, Anka standzuhalten — das war das Schwierigste, obwohl Anka sich zurückhielt, obwohl sie es zu wissen schien. Aber was half das, wenn sie es nicht begreifen, nicht nachfühlen konnte? Die Gesunden, die Unverletzten konnte sie alle mitreißen — sie wollte es nicht einsehen, dass sie über Lindes Art zu leiden keine Macht hatte. Das brachte sie auf. Man merkte ihr an, dass sie sich zurückhalten musste, um nicht ungerecht zu werden.
„Grüß Dich, Linde. Was ist? Kommst mit ins Konzert heute Abend?”
Sie hockte auf der Schreibtischplatte, nahm eins von den trockenen Keks, die da auf einem Teller lagen. Man sah ihre kräftigen Zähne. Die Sonne spiegelte aus einer Fensterscheibe schräg herüber und ließ ihr Haar aufleuchten. Draußen vor dem Fenster ragte die Kirche mit Turm und Kuppel auf — Sankt Niklas. Um ein Vielfaches überstieg sie die stattlichen Häuser an ihrem Fuße; breit und hoch ragte sie in das Flimmern des Nachmittags. Weißgrün leuchtete die Patina der Kuppel.
„Geh, sei nicht bös, Anka”, sagte Linde. „Ich mag keinen Mozart heut Abend. Fränzi, magst du nicht mit?”
„Ach, Fränzi, der Notnagel”, sagte ich, zweifelnd, ob es richtig sei anzunehmen. Lust hatte ich schon, aber schließlich war es Anka, die die Karten vergab. „Vielleicht gibt’s noch andre, die gern möchten!”
„Geh, sei so nett und sei ein Notnagel, Fränzi”, sagte Anka kauend — „puh, das Zeug schmeckt wie Sand. — Die Karten waren eh schon teuer genug, soll ich jetzt noch damit hausieren gehn? Ich muss jetzt zum Boden, Christophs Sachen suchen. Die Frantiseks wollen sie holen heut abend. Kommst mit, Uhrengeneral? Kannst mir die Truhen aufhalten. Da braucht’s einen starken Mann.”
Der Uhrengeneral, zweifelnden Blicks, ballte die Fäuste, zog die Unterarme an und ließ sie wieder sinken. Anka rutschte vom Schreibtisch.
„Komm nur, drück dich nicht. Dazu reicht’s schon.” Fort war sie. Linde lächelte.
„Ein Goldkerl ist sie, die Anka. Versteht nicht, warum ich mich so haben kann wegen der Vogelscheuche — so nennt sie ihn jetzt, hat ihn wahrscheinlich im Stillen immer so genannt. — Ich versteh’s selber nicht.”
„Ich glaube, es ist schlimm, wenn man etwas nicht bekommt, was man haben möchte. Aber vielleicht ist es noch schlimmer, wenn man etwas nicht geben kann, was man geben möchte.”
„Laß nur, Fränzi, ich komm schon wieder heraus. Es dauert halt seine Zeit.”
„Vielleicht wär’s besser, du würdest schreien und weinen?”
Sie schüttelte den Kopf. „Laß nur, Fränzi, es kommt schon alles wieder.”
„Ist es wahr, dass er dich auf einmal soviel arbeiten lässt?”
Sie nickte und lächelte bitter. „Ich kann ja nichts sagen, jetzt erst recht nicht. Stell’s dir doch nur mal vor! Es weiß ja auch keiner außer mir Bescheid in dem Zettelkram, nicht mal er kennt sich richtig aus.”
„Ich möchte dich mal wieder richtig draußen haben in Luft und Sonne; richtig wandern müssten wir mal, damit du wieder die Alte wirst”, sagte ich.
Sie zuckte die Achseln. „Zu Pfingsten vielleicht. Die Elbe entlang, das wollt ich schon immer gern.”
„Wollen wir’s nicht gleich festmachen?”
Sie nickte und sah müde aus. „Machen wir’s nur.”
Es war fünf. Wenn ich zum Konzert pünktlich sein wollte, musste ich jetzt nach Hause, mich umziehen. Ich fragte Anka nach der Karte, sie hatte sie lose in der Jackentasche und steckte auch den Geldschein, den ich ihr gab, lose in die Tasche. Dann ging ich.